Der Mensch als Beherrscher der Natur
von Curt Grottewitz und Wilhelm Bölsche
Bildschmuck und Initialen: A.W.Baum, Berlin
Inhalt
- Zur Einführung
- Veränderungen in der deutschen Baumwelt
- Ausländische Bäume in Deutschland
- Neue Fruchtgehölze in Deutschland
- Einwanderung der Getreidearten in Deutschland
- Eingeschleppte Pflanzen
- Aussterbende deutsche Tiere
- Veränderungen in der deutschen Vogelwelt
- Die Kultur unserer Gartenblumen
- Gartenkunst
- Der Mensch als gestaltende Macht in der Natur (Von Wilhelm Bölsche)
Abbildungen
- Italienische Landschaft mit Agaven, Opuntien, Pinien, Zypresse
- Rest eines mitteleuropäischen Urwaldes in Böhmen
- A Eibe, B Wacholder
- Elsbeere
- A Weiße Maulbeere. B Schwarze Maulbeere. 1 und 2 Maulbeerspinner. 3 Raupe. 4 Kokon
- Roßkastanie
- Friedhof mit Lebensbäumen und Trauerweide
- A Weymouthskiefer. B Gemeine Kiefer
- Getreidearten der Pfahlbauzeit
- Roggen. Zweizeilige Gerste
- Hafer
- Weizenarten
- Stechapfel
- Wasserpest
- Alpensteinbock
- Luchs
- Apollofalter
- Haubenlerche
- Girlitz
- Schwarzer Storch
- Weißer Storch
- Tulpen
- Motiv aus dem Englischen Garten in München
- Motiv aus Sanssouci
- Versailler Park
- St.-Bernhards-Hund
- Dingo australischer Wildhund
- Wildpferddarstellungen des diluvialen Menschen
- Urwildpferde
- Urstier. Relief vom lstartor in Babylon
- Mais. Tabak
- Kartoffel
- Kartoffelkäfer in verschiedenen Färbungen, zweieinhalbmal vergrößert
- Schlußbild
I. Zur Einführung

or zwanzig Jahren habe ich einmal geschrieben, daß Grottewitz' Schriften im Herzen unseres Volkes fortleben würden. Diese Prophezeiung ist wahr geworden. Sie haben keinen rauschenden Augenblickserfolg gehabt wie so manches vergängliche Tagesbuch, aber sie dauern still weiter und grünen alljährlich neu wie der deutsche Wald, den ihr Verfasser sogeliebt.
Der Mann, der sich selbst den Schriftstellernamen gegeben, den seine Werke tragen, war kein Kind des Glückes. Kurz nur war die ihm vergönnte Lebensbahn, noch nicht ganz vierzig Jahre, dann raffte ihn ein Unglücksfall beim Baden in einem märkischen See dahin.
In diesen engen Grenzen hat sein reicher Geist unstet nach einer ganz richtigen Stelle zum Ausleben gerungen, meist eingeengt von der äußeren Not auch noch des wirtschaftlichen Tageskampfes. Seine ursprünglichen Studien gingen rein ins Literarische, er fühlte freien Dichterberuf, wie er immer auf seiten der Freiheit stand. Ohne hier zum ausgeklärten Ziele zu kommen, ging er dann über zur Naturwissenschaft, der er äußerlich zugleich als praktischer Landwirt sich zu nähern suchte. Wieweit er sich noch als selbständiger Forscher bewährt haben würde, ist durch seinen jähen Tod unbeantwortet geblieben. Mut und Gedanken hatte er sicherlich dazu.
Jedenfalls sollte aber ein anfänglich nur kleiner Seitenweg dieser späteren Jahre seine glücklichste Tat werden. Der nicht ganz ausgereifte Poet und Schriftsteller fand eine wunderbar schöne und leichtverständliche Form, gegebenen Stoff aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Fachgebieten volkstümlich darzustellen. Dabei faßte er Volk im weitesten Sinne; der schlichteste Arbeiter sollte verstehen können, was er schrieb.
In der kurzen Zeit, die ihm zur eigenen wie fremden Lehre vergönnt war, hat er hier den unbestrittenen Erfolg errungen, einer unserer besten naturwissenschaftlichen Darsteller zu sein — einer der wenigen, die überhaupt auf diesem Gebiet und in seiner Zeit Ernstes geleistet haben.
Curt Grottewitz hat selbst keine Muße mehr gefunden, auch nur das, was er so in verschwenderischer Fülle auf losem Zeitungsblatt in die breiteste Volksmasse hinausstreute, zu geschlossenen Büchern zu sammeln. Erst aus seinem Nachlaß sind jene Dauerwerke, die heute noch fortleben („Sonntage eines Großstädters in der Natur" und „Unser Wald") pietätvoll zusammengestellt worden. Manche schöne Einzelblüte lag noch verstreut und lockte zum nachträglichen Kranz. So ist noch spät, aber sicher nicht unnütz und unlieb, auch diese Sammlung hier entstanden.
Sie braucht keinen Vergessenen zu wecken, sondern wendet sich nur neu an den alten, nie zerstreuten Leserkreis jener früheren Grottewitz-Gemeinde. Der Ton ist der gleiche volkstümlich bescheidene und doch künstlerisch gehobene wie dort. Im Volke selbst, so hoffen wir, ist aber in den Jahrzehnten seither der Sinn zur Heimat und dem ewigen Jungbrunnen ihrer Natur nur reifer und kräftiger geworden. Ich denke, auch die Volksbildung als solche ist inzwischen gewachsen oder hat doch heute freiere Luft zum Wachsen, so daß von ihr aus noch mehr entgegengekommen wird, als den ersten Pionierversuchen des jungen Meisters damals noch beschieden sein konnte.
Nicht so sehr vom Sein als vom Wechsel unseres Naturbildes erzählt dieses Werk.
Manchem erscheint ja, wenn er von der harten Arbeit in den Wald oder die Heide hinauskommt, wenn er wandern und sich ausleben darf da draußen, die Natur als das ewig Beharrende und gerade so beruhigende. Einzelschicksal des Menschen wechselt, die Welle der Kultur steigt und fällt, furchtbare Stürme des Völker- und Soziallebens brausen über uns hinweg; da geht der Bedrängte, Müde wohl zu Baum und Tier, Quelle und Berg, die als stiller Chor in ewiger Ruhe dahinterstehen. „Auf den Bergen ist Freiheit!” singt der Dichter, „Der Hauch der Grüfte steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte.”
Und doch ist auch das nicht ganz wahr.
Wir sind nicht umsonst Kinder der Natur. Auch sie unterliegt einer unaufhaltsamen, wenn auch in großen Wirkungen meist unendlich langsamen eigenen Entwicklung. Innere Gesetze, seit Urtagen niemals ruhend, formen weiter an ihr. Unser Erdball, in großen Zusammenhängen des Alls mitschwingend, verschiebt allmählich sein Klima, seine Land- und Wasserverteilung, seinen Sternenhimmel, wie er das in den ungeheuren Zeiträumen der Vorwelt schon mehrfach getan. Mit Wärme und Boden aber machen sich andere Lebensgeschlechter, andere Anpassungsformen der Tiere und Pflanzen geltend.
Freilich: für das kurze Leben des einzelnen, ja, für die wenigen Jahrtausende ganzer Kulturvölker geht dieser Wechsel im reinen inneren Naturbann zunächst so gemächlich, daß unsere gewöhnliche Heimatsbetrachtung, unsere Heimatsliebe und unser Heimatsvertrauen kaum davon Notiz zu nehmen brauchen, sofern nicht rein wissenschaftliches Interesse in Frage kommt.
Aber das große, unruhige Naturkind Mensch ist ja auch selber mit im Spiel, und es rückt allerdings viel nachdrücklicher und fühlbarer am Zeiger der großen Uhr.
Vom Tage, da der Mensch die Natur auf seinem Planeten zu beherrschen begann, hat er sie auch zu verändern, umzuschaffen begonnen nach seinem Bilde — auf seinen Vorteil, sein Glücksideal, sein Schönheitsempfinden. Vielfach unbewußt, manchmal gegen sein Wollen, aber immerfort und unaufhaltsam mit dem ungeheuren Tempo, das allem Menschenfortschritt innewohnt, der in einer, geologisch gerechnet, geradezu lächerlich winzigen Zeitspanne eine ganze Kultur aufgebaut und Dutzende von Malen schon wieder um- und umgeordnet hat. Alle Geschichte, alle kulturelle, wirtschaftliche, politische, die ein Volk erlebt hat in den Jahren seiner Existenz, spiegelt sich heute nicht nur als festes Erbe in der Seele von jedem von uns Nachkommen, der heute dort neu hineingeboren und hineinerzogen wird; sondern der Kundige sieht sie auch bereits in der Landschaft selber ringsum in den deutlichsten Zügen abgeprägt. Zuerst traf das nur das engere Gebiet, wo gerade ein Einzelvolk saß. Aber machtvoll stellte sich allmählich der Verkehr der Völker untereinander dazu. Als phönizische Händler vor dreitausend Jahren zum erstenmal aus den Mittelmeerländern nach unserem Norden zogen, Zinn und Bernstein dort einzuhandeln gegen Purpurgewänder, bunte Gläser und feurigen Südwein, da haben sie gewiß nicht geahnt, daß im Gefolge solchen Handels dermaleinst die ganze Natur des Nordens und Südens sich neu vermischen, Pflanzen und Tiere aus- und einwandern, sich versetzen und absterben würden, daß die Natur gleichsam selber durch die von der Menschentechnik geschaffenen Pforten in neuen Handelsaustausch treten werde.
Da mag nun wohl manchen die melancholische Stimmung überkommen: also es dauert auch da draußen nichts. Wie der Fels von Helgoland allmählich ins Meer stürzt, so bröckelt auch das Land unserer Väter ab — „andre Zeiten, andre Vögel” woran sollen wir uns also halten?
Das ist doch auch wieder verfrüht und in vielem ganz unrichtig. Auf der einen Seite hat dieser Wandel der Natur auch unendlich viel Gutes gebracht. Wir würden uns schwerlich wohl fühlen in den ungesunden und unwegsamen nassen Sumpfwäldern unserer altgermanischen Vorfahren, wenn wir dahin zurückversetzt werden sollten. Der Italiener von heute kann sich sein Land gar nicht mehr denken ohne die Goldorange im dunkeln Laub, die von Baum zu Baum rankende Rebe, den Opuntienkaktus und die himmelhoch blühende Agave, alle deutschen Italienfahrer seit Goethe haben es so gesehen und sich daran berauscht — und doch wissen wir ganz genau, daß Rebe und Orange erst durch menschlichen Kulturhandel aus dem Orient importiert, Kaktus und Agave gar erst aus Amerika seit Kolumbus' Zeiten eingewandert sind. Andererseits wird keine Menschenzutat gerade gewisse tiefste und liebste Züge von Heimatbildern verwischen können. Der Zauber des deutschen Frühlings, den wir in den wärmeren Zonen

Abb. 1. Italienische Landschaft mit Agaven, Opuntien, Pinien, Zypresse.
so schmerzlich vermissen, wird auch unseren fernsten Enkeln noch treu bleiben, und der Schweizer wird seine Berge, mit denen er so verwurzelt ist, so bald nicht missen.
Wiederum manches, das jetzt häßlich aus Uebergangswegen unserer Technik in die Natur eingreift, wird sich gleichsam selbst in absehbarer Zeit wieder herausregulieren. Wenn der Fabrikschornstein heute eine liebliche Landschaft verschandelt, so dürfte er wohl aus inneren Gründen des Fortschritts wieder verschwinden, wenn wir bessere Mittel finden, den Rauch technisch zu bewältigen und zu verwerten. Der Eisenbahndamm, der zuerst unschön und fremd zwischen die Eigenlinien der Natur und Bodenkultur trat, zeigt sich aus der Fülle eben dieser Natur in kurzer Frist wieder mit Grün bekleidet, daß das Auge ihn kaum noch findet, und vielleicht ist auch die Höhe seiner notwendigen Verbreitung mit Anbruch unserer neuen Periode der Flugtechnik überhaupt schon wieder überschritten, ähnlich wie das häßliche Telegraphennetz der freien Welle weicht. Ein vernünftiger Steinbruchbetrieb oder Moorabbau, eine richtige Forsttechnik brauchen auch keineswegs die Natur da zu zerstören, wo Menschengemüt sich ihrer Schönheit erfreuen will.
Wohl allerdings erwächst hier für uns eine ganz bestimmte Pflicht: dem übermäßig und überflüssig raschen Tempo unserer Menschenverschiebung und Menschenzerstörung im vergänglichen Augenblicksbedürfnis gelegentlich eben aus Menschenverstand wieder entgegenzutreten, also allen fühlbaren Auswüchsen gegenüber einen bewußt bremsenden Naturschutz und Heimatschutz zu treiben. Aus dem Menschen selber als einem Stück nicht nur Natur, sondern auch höherer Vernunftnatur muß hier die Korrektur auch für das Naturbild ebenso selbstverständlich kommen.
Wir werden überall mit Recht und allen Mitteln protestieren, wo kurzsichtige Momentinteressen einzelner köstliches vaterländisches Naturgut antasten, das mindestens noch vielen Generationen unserer Nachkommen zur Freude und Belehrung hätte dienen können. Wissenschaftliche und rein gemütliche Interessen kommen hier zusammen. Denn unsere Heimat gehört auch der Forschung, und wenn etwa ein Tier heute willkürlich ausgerottet wird, so ist das auch dort ein schlimmer Verlust, den kein fremder Import ersetzen kann. Wie wenig wissen wir noch vom Nestbau unserer bekanntesten Vogel, vom stillen Lebenslauf selbst mancher volkstümlichsten Tiere. Es erregte Aufsehen in Fachkreisen, als neuerlich ein Zoologe feststellte, daß wir noch heute nicht klar über den Maulwurfsbau unterrichtet seien; wenn uns nun eine vergängliche Damenmode um seines weichen Fellchens willen vorher den ganzen Maulwurf vernichtet hätte! Erfreulicherweise blüht aber auch dieser Naturschutz heute in weitestem Umfang auf und hat endlich auch unsere amtlichen Kreise zu beschäftigen begonnen. Staatliche Stellen für Naturdenkmalpflege, bis ins einzelne bestimmter Tier- und Pflanzennamen gehende Schutzgesetze, Inventarisierung aller in Betracht kommenden Werte mit Einzeichnung in besondere Heimatkarten, Interessierung von Schulen, Forstverwaltungen, Universitätskreisen sind in allen Teilen des Reiches mit Erfolg in die Wege geleitet, wobei diesmal das erfreulichste Zusammenwirken aller Parteien zu bemerken war. Als ganz besonders wirksam haben sich auch bestimmte Reservate, Naturschutzgebiete, Asyle an geeigneten Stellen bewährt: also mehr oder minder große, besonders schöne und an „Natururkunden” reiche Einzelteile unserer Landschaft, die vorläufig jeder künstlichen Veränderung entzogen und auch technisch nicht ausgebeutet werden sollen, sondern bei freiem Weiterblühen doch allen Schutz und Zweck eines Museums genießen.
Ein solches Reservat umfaßt z. B. bei Chorin in der Nähe Berlins ein hochcharakteristisches See-, Moor- und Gletschermoränengelände von 167 Hektar Umfang. Andere schützen Teile der Lüneburger Heide, das vom Steinbruchbetrieb bereits furchtbar verheerte rheinische Siebengebirge, den noch erhaltenen Urwaldrest in Oldenburg, die Isarlandschaft oberhalb Münchens, unter fremder Regie den ebenfalls urwaldhaften Böhmer Wald, ferner die Potsdamer Pfaueninsel, gewisse Riesendünen unserer
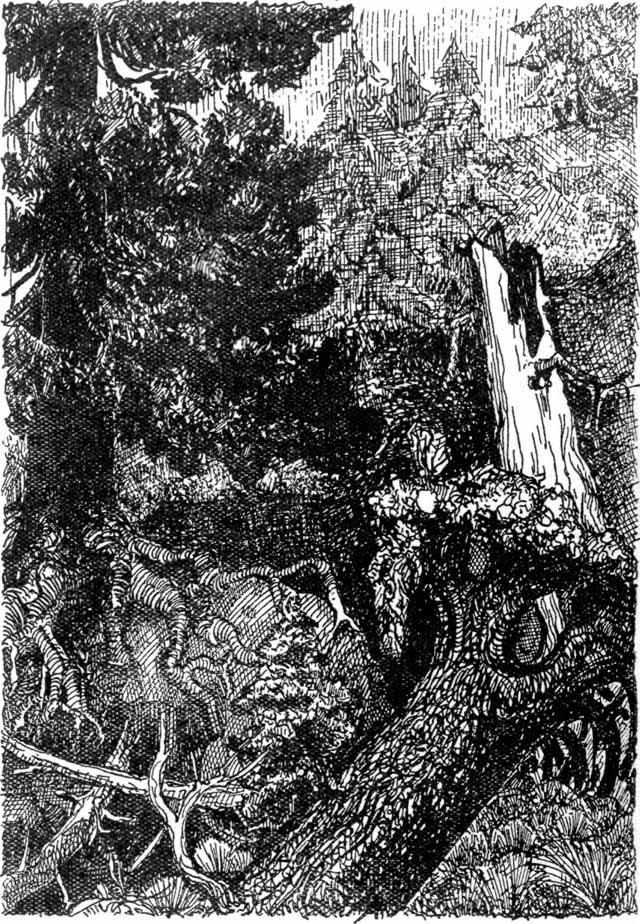
Abb. 2. Rest eines mitteleuropäischen Urwaldes ln Böhmen.
Meeresküste, wertvolle Vogelkolonien, Hochmoore, selbst bis in die deutsche Alpenwelt bei 2000 Meter Höhe gehen sie schon. Ganz kürzlich ist die sogenannte kleine Schneegrube im Riesengebirge, die noch ein fast unverändertes Gletscherbett der Eiszeit vor Augen führt und zum Teil mit den wunderbarsten hochnordischen Pflanzen als lebendigem Ueberbleibsel dieser Kälteperiode vor vielen tausend Jahren bestanden ist, zu solchem unveränderlichen Naturschutzgebiet erklärt und dadurch, wie zu hoffen, zu Lust und Lehre ferner Urenkel gerettet worden.
Auch einzelne alte Bäume und künstlerisch und wissenschaftlich interessante einzelne Gesteinsklippen (Basaltsäulen, Quadersandstein) und ähnliches können durch die betreffenden Gesetze schon jetzt für unantastbar erklärt werden.
Wo der technische Betrieb mit seiner wachsenden Ausdehnung als solcher aus Wirtschaftsgründen nicht auszuschalten ist, da kann dieser straff organisierte Heimatschutz doch in vielen Fällen beratend und regulierend sich zur Seite stellen, so bei Wasserspiegelsenkungen, Austrocknen der Moore, vor allem dem landschaftlich bedrohlichen Steinbruchbetrieb. Wenn wir hören, daß um 1904 der Abbau des Quadersandsteins in der Sächsischen Schweiz jährlich zweihunderttausend Kubikmeter Steine im Werte von zwei Millionen Mark bewegte und viertausend Arbeiter beschäftigte, so kann solcher Wirtschaftsbetrieb natürlich nicht im heutigen System ohne weiteres abgestellt werden, aber es wird doch als vernünftiger Rat zu hören sein, daß nicht gerade die unersetzliche Schönheit der Elbtalränder zunächst davon betroffen, sondern daß der Abbau ins tiefere Land hinein verlegt werde.
Es sei auch der Name des Mannes hier genannt, der zuerst hochverdienstlich diese gesamte deutsche Schutzforderung in amtliche Kräfte umgesetzt hatte, des verstorbenen Professors Conventz in Danzig.
Es war dem Hauptverfasser dieses Werkes nicht vergönnt, den ganzen Umfang dieser Bestrebungen (die zum Glück auch der Weltkrieg nicht gelähmt hat) noch zu erleben, sonst würde er als Gegengabe seiner Betrachtungen wohl noch öfter und nachdrücklicher auch in seinem Text darauf hingewiesen haben
Andererseits soll der einzelne heimische Wanderer und Naturgenießer sich aber jederzeit auch voll bewußt sein, daß er selber gerade als Genießer in erster Linie auch als solcher Schützer für seine Person verpflichtet ist. Die Natur ist sein großer Volksgarten, wo er auch ohne Gitter und Polizeiplakat immerzu wissen soll, daß man hier nicht willkürlich die schone Naturgottesgabe ausreißt, zertritt und herunterschlägt. Wie überall, so muß auch hier der Begriff Heimat verpflichten — verpflichten zum Dienst an unseren Kindern und Enkeln, die auch an dieser Natur noch ihr Anrecht haben wollen.
Jenen großen und letzten heiligen Wandel aller Dinge aber, den wir auch an dieser Stelle nicht ändern können und schließlich auch nicht wollen — ihn mögen wir still in die Hand des großen Weltgeschickes legen, in das wir alle nun einmal in dieser Natur hineingeboren sind. Auch wir müssen geistig und wirtschaftlich immer weiter — neuen und, wie wir doch wenigstens hoffen, besseren Zielen zu — so wird die Natur zuletzt auch wohl wandern dürfen und zum Guten wandern sollen. Und wo wir selber durch unseren Menschenwandel diesen Naturwandel unterstützen müssen — nicht leichtsinnig, aber auch im Gesetz — da werden wir denken, daß — wie der Philosoph uns wohl sagt, Raum und Zeit seien zuletzt nur menschliche Denkformen — so auch der Begriff Heimat in gewissem Sinne nur eine Tat unseres eigenenSelbst darstelle. Wir sind Kinder unseres Bodens. Aber das Kind ist nicht bloß vom Vater abhängig, sondern es lernt auch der Vater vom Kinde. Das ist eine ewige Wahrheit, die auch hier bleiben muß und zum guten Ende doch auch zur menschlichen Größe gehört.
Wenn in unendlichen, unfaßbaren Fernen wirklich auch die letzte Scholle einmal dessen abgenagt und neu umgesetzt sein sollte, an dem unsere Liebe heute noch so rührend hängt — dann werden auch Geist und Herz unserer Enkel im weitesten Gliede sich so anders und neu eingestellt haben, daß sie wohl auch eine neue Scholle vertragen, ohne ihre edelsten Idealguter selbst deswegen verlieren zu müssen.
Inzwischen ist aber bis dahin noch weit und es gilt noch resolute Arbeit für uns von heute genug: nicht nur in jenem Sinne, unsere Heimatsnatur so lange zu schützen, wie es geht, sondern auch immer weitere Menschenkreise heranzuerziehen zur Liebe an diesem Heimatsbild. Diese Liebe wird auch denen ein unschätzbares Erbe sein, die sich einmal auf eine anders gewendete Natur einstellen müssen und das Dichterwort buchstäblich als wahr erleben: „Andre Zeiten, andre Vögel.” Wieder zu dieser Naturliebe gehört aber immer auch ein Teil Denken und Wissen, und das war es, was ein solcher Mann wie Grottewitz seinem Volk wesentlich vermitteln wollte.
Der Zweck dieses Buches ist in erster und letzter Linie, schöne uns noch erhaltene Worte von Grottewitz selbst in neu dauernder Form weiterzugeben. Das war bestimmend für die Arbeit des Herausgebers.
Es mußte ihre Aufgabe sein, möglichst wenig am Grottewitzschen Text selbst zu ändern, dessen Wert schr oft weniger in dem beruht, was er sagt, als wie er es sagt. Einzelne der dargelegten Dinge ließen oder lassen verschiedene wissenschaftliche Deutungen zu. Es schien aber nicht angemessen, hier willkürlich von einem anderen Standpunkt hineinzukorrigieren, sondern Grottewitz als solcher soll zu uns reden, soll uns sagen, wie er es meinte.
Dagegen schien noch ein zusammenfassendes Schlußbild erwünscht, zu dem er nicht mehr gekommen — und das habe ich, ganz als Eigenarbeit, die mein eigener Name deckt, beigefügt.
Schreiberhau i. R. 1928.
Wilhelm Bölsche.
II. VERÄNDERUNGEN IN DER DEUTSCHEN BAUMWELT

elche ungeheueren Veränderungen die Natur seit etwa zweitausend Jahren in Europa erfahren hat, das grenzt fast ans Unglaubliche. Damals gaben undurchdringliche Wälder und unüberschreitbare Sümpfe die Hauptphysiognomie großer Teile unseres Erdteils ab, es war dort eine rauhe, unkultivierte Wildnis, in der furchtbare Raubtiere den Menschen bedrohten und mächtige Bäume mit wirrem unfruchtbarem Unterholz menschliche Ansiedlungen erschwerten. Wie anders sieht es heute in Europa aus! Es gibt jetzt nur noch wenige Gegenden, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt, wo es ihr noch freisteht, ihre Gebilde ohne Rücksicht auf den Schaden oder Nutzen der Menschen hervorzubringen. Im allgemeinen ist heute jeder Fleck europäischer Erde mehr oder weniger Gegenstand menschlicher Kultur. Der Mensch ist es, der bestimmend in die Gesetze der Natur eingreift, der den Boden zubereitet und die Fruchtbarkeit erhöht, der bestimmte Pflanzen, die er als Unkraut bezeichnet, ausrottet, und andere Pflanzen systematisch anbaut, pflegt und möglichst veredelt.
Das Tempo der Naturumgestaltung ist aber im letzten Jahrhundert noch bedeutend schneller geworden.
Die eigenartige Kulturrichtung, die bereits seit vielen Jahrzehnten in allen zivilisierten Staaten herrscht, hat die Natur Deutschlands mehr verändert, als es viele frühere Jahrhunderte zusammen vermocht haben. Zwei Momente treten dabei in den Vordergrund.
Einmal dehnt sieh die menschliche Tätigkeit so fieberhaft schnell über alle Natur aus, daß diese in ihrem Platz immer mehr beschränkt wird.
Dann aber hat das Bestreben, alles augenblicklich Unrentable durch Rentables zu ersetzen, der Natur, auch wo sie im übrigen sich selbst überlassen wird, einen besonderen Stempel aufgedrückt.
Diese Züge machen sich in der Tierwelt, viel auffälliger aber noch in der Pflanzenwelt und da besonders auch in dem Bestand und der Verteilung der Baumarten bemerkbar.
Neben der allgemeinen Vereinfachung und Vereinheitlichung tritt dagegen in einzelnen Fällen das erfreuliche Streben hervor, die Mannigfaltigkeit der Natur zu erhalten oder womöglich noch zu erhöhen.
Wenn man das Gesamtbild der Natur in Deutschland betrachtet, so wird man seit der historischen Zeit drei deutlich voneinander abgegrenzte Epochen unterscheiden können. Jene alte Urwaldzeit, dann die Zeit, in der der Kulturboden und die Naturlandschaft in gleichem Verhältnis zueinander standen, und schließlich die neueste Zeit, die durch die intensive Bodenwirtschaft gekennzeichnei wird, bei der der Mensch auch die Wiesen, Moore und Wälder nach einem strengen System unter sein Joch bringt.
Manche Forscher sind der Ansicht, daß Deutschland in ältester Zeit vollständig mit Urwald bedeckt gewesen ist, auch die heutigen Sümpfe, Moore, Wiesen, Heiden und Steppen. Für die norddeutschen Heiden hat es der verdienstvolle Pflanzengeograph Graebner wahrscheinlich gemacht, daß ihr Boden allmählich durch die Einwirkung des Regens immer mehr der Nährstoffe beraubt und infolgedessen immer ärmer geworden ist. Wo früher noch Birke und Kiefer gedeihen konnten, da vermag jetzt der Boden nur noch das niedrige Heidekraut zu ernähren.
Wie dem auch sei, jedenfalls wurde unter dem Einflüsse des Menschen der Urwald nach und nach gelichtet. Den besten Boden, der von Bäumen bedeckt war, nahm der Mensch zum Körner- und Futterbau in Beschlag. Der Wald erhielt sich nur da, wo der Boden zu landwirtschaftlichen Zwecken nicht zu gebrauchen war. Also in den Gebirgen, wo die steilen Gehänge schwierig oder gar nicht zu bearbeiten sind, der Kulturboden außerdem der Gefahr ausgesetzt ist, von Regengüssen zerrissen und ins Tal getragen zu werden. Auf den höheren Bergen ist außerdem das Klima der Ansiedlung des Menschen und der Erhaltung der Baumwelt nicht günstig. Auch in der Ebene haben sich kleine Wäldchen an steilen Talwänden bis in die Gegenwart herübergerettet. Größere Ausdehnung in der Ebene hat der Wald noch in den dürren Sandgegenden des nordöstlichen Deutschlands, hier ist der Boden zum Ackerbau zu schlecht. Abgesehen von diesen landwirtschaftlich ungünstigen Verhältnissen, die hier den Fortbestand der Baumvegetation sicherten, erhielt sich der Wald in vorteilhaften Lagen nur da, wo er Besitz des Staates, einer größeren wohlhabenden Gemeinde oder eines reichen Magnaten war.
So lagen die Verhältnisse bis vor etwa fünfzig Jahren. Von da an begann eine neue Periode in dem Verhältnis zwischen Mensch und Baumwelt.
Von jetzt an ist der Begriff „rationelle Wirtschaft” das leitende Prinzip bei allen kulturellen Veränderungen, die mit der Natur vorgenommen werden.
Im allgemeinen ist diese Periode der Baumvegetation ungünstig gewesen. In kurzer Zeit sind in den fruchtbaren Gegenden Mittel- und Süddeutschlands unzählige Buschwäldchen ausgerodet worden, obwohl sie in landwirtschaftlich ungünstiger Lage standen. Aber die verbesserte Technik, die künstlichen Düngemittel, die fast zur Mode gewordene und mitunter sehr kostspielige Sucht, Meliorationen vorzunehmen, hat den bisherigen Waldesboden immer mehr in das Bereich des Landwirtes gezogen. Auch die waldreichen Sandgebiete Norddeutschlands haben in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Lichtung erfahren. Die Beobachtung, daß in frisch gerodeten Wäldern Roggen, zumal bei künstlichem Dünger, bisweilen sehr gut gerät, führte zu umfangreichen Ausrodungen. Der Boden verarmte freilich immer mehr, es stellten sich Mißernten ein, Mittel und Energie zur Aufforstung fehlten oder wo sie vorhanden waren, schlug der Versuch fehl, wie denn die Kiefer nach landwirtschaftlicher Nutzung des Bodens nicht leicht mehr aufkommt. So liegen denn jetzt weite Felder, die früher Kiefernwald trugen, brach und veröden und verarmen. Sie tragen zudem dazu bei, die Trockenheit des Klimas, den größten Nachteil der norddeutschen Sandgegenden, zu erhöhen.
Die Bereitwilligkeit, große Waldstriche auszuroden, wurde und wird noch jetzt durch die verlockenden Angebote der Holzhändler gefördert, die ihrerseits die Bedürfnisse der Bergwerke an Grubenholz und die stetig wachsende Nachfrage der Holzstoffabriken zu befriedigen haben. In den norddeutschen Kieferngegenden sind große Waldbestände im Besitze von Privatleuten, besonders von mittleren und kleineren Bauern, die den Lockungen zur Ausrodung ihrer Wälder nicht widerstehen können. Und doch birgt diese augenblicklich günstige Ausnutzung des Bodenertrags große Gefahren für die Zukunft. Auch die Gemeinden, die reichen Gutsherren, ja selbst der Staat hüten in letzter Zeit nicht mehr so sorgfältig wie früher ihren Waldbesitz. Die großen Angebote von Bau- und Terraingesellschaften, die Ausdehnung der Städte, die für den Moment vorteilhafte Einnahme aus dem geschlagenen Holz verringern fortgesetzt den Waldbestand.
Der Wald selbst, die Baumwelt hat jetzt ein neues Gepräge erhalten. An die Stelle des alten Plänterwaldes, der in Anlehnung an die Natur Bäume aller Jahrgänge gemischt enthielt, ist der moderne Forst getreten, in dem in regelmäßigen Revieren Bäume nach Jahrgängen geordnet sind. In solchen Forsten, in denen einzelne Reviere auf einmal kahl gehauen und ebenso in einem Jahre wieder aufgeforstet werden, ist natürlich die alte Mannigfaltigkeit des Waldes ganz verschwunden, es ist kein Wald mehr, sondern eine Baumplantage.
Diese Forstwirtschaft ist jetzt überall in Deutschland durchgeführt, selbst in den Gebirgen, wenn sie hier auch nicht ganz so streng gehandhabt wird. Nur kleine Privatwälder, besonders Buschwälder an Abhangen, einzelne Partien unkultivierter Gegenden, z. B. des Böhmer Waldes, haben noch die alte Naturwildheit bewahrt.
Dieser Forstbetrieb bietet gewiß sehr viele Vorteile, er erleichtert die Wirtschaft außerordentlich, macht sie übersichtlich und vereinfacht die Abholzung und Abfuhr der Stämme. Er begünstigt aber auch das Auftreten verheerender Krankheiten, die besonders leicht über eine junge Schonung herfallen. Die Aufforstung ist öfter durch Witterungseinflüsse gefährdet, da die jungen Pflanzen den fehlenden Schutz der alten Bäume nicht immer leicht ertragen. Nach F. Petzi waren im Bayrischen Walde um das Jahr 1850 noch siebzig Prozent des Bestandes Tanne, jetzt sind es nur noch dreißig Prozent, ja, in Jungständen kaum zwanzig Prozent. Petzi sagt, daß diese Erscheinung durch die heutige Forstwirtschaft hervorgerufen sei. Auf Revieren, die durch Kahlhieb vollständig von allem Baumwuchs entblößt sind, kommt die Tanne nur schwer auf.
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die heutige Forstwirtschaft nicht nur das Bild des Waldes, sondern auch den Artenbestand verändert.
Zwar ist auch schon früher unter dem Einfluß des Menschen mitunter eine Verschiebung von Baumarten vorgekommen, so ist der Thüringer Wald früher mit Laubbäumen bedeckt gewesen und erst allmählich ist an ihre Stelle der Fichtenbestand getreten.
Aber jetzt wird diese Verschiebung systematischer vorgenommen, der gemischte Laubwald weicht mehr und mehr den reinen Beständen von Buchen, Eichen, Fichten und Kiefern.
Das führt zu einer großen Eintönigkeit, die vom Standpunkte landschaftlicher Schönheit tief zu bedauern ist. Die weniger nützlichen Bäume werden immer mehr unterdrückt. Linden, Ahorn, Weiden, Erlen, selbst Ulmen und Birken werden in den Forsten immer seltener.
Es ist merkwürdigerweise bisher noch nicht vorgekommen, daß ein Baum Deutschlands unter dem Einflüsse der Kultur vollständig ausgerottet worden wäre.
Aber schon nach Ablauf der zweiten Periode waren einige Baumarten selten geworden, und die jetzige Phase der Waldwirtschaft hat natürlich die Existenzbedingungen jener Arten noch ein bedeutendes verschlechtert.
Es handelt sich hier um drei Bäume; die Eibe (Taxus) und zwei Kernobstarten, die Elsbeere und den Speierling.
Die Eibe ist bereits in früherer Zeit selten geworden, da sie wegen ihres vorzüglichen Holzes sehr begehrt war und der Wald nach dieser Baumart abgesucht wurde. Das langsame Wachstum, die geringe Vermehrungsfähigkeit machen die Eibe für unsere raschlebige Zeit untauglich, in Norddeutschland kann man die wildwachsenden Taxusexemplare zählen, und auch im übrigen Deutschland sind sie selten genug.
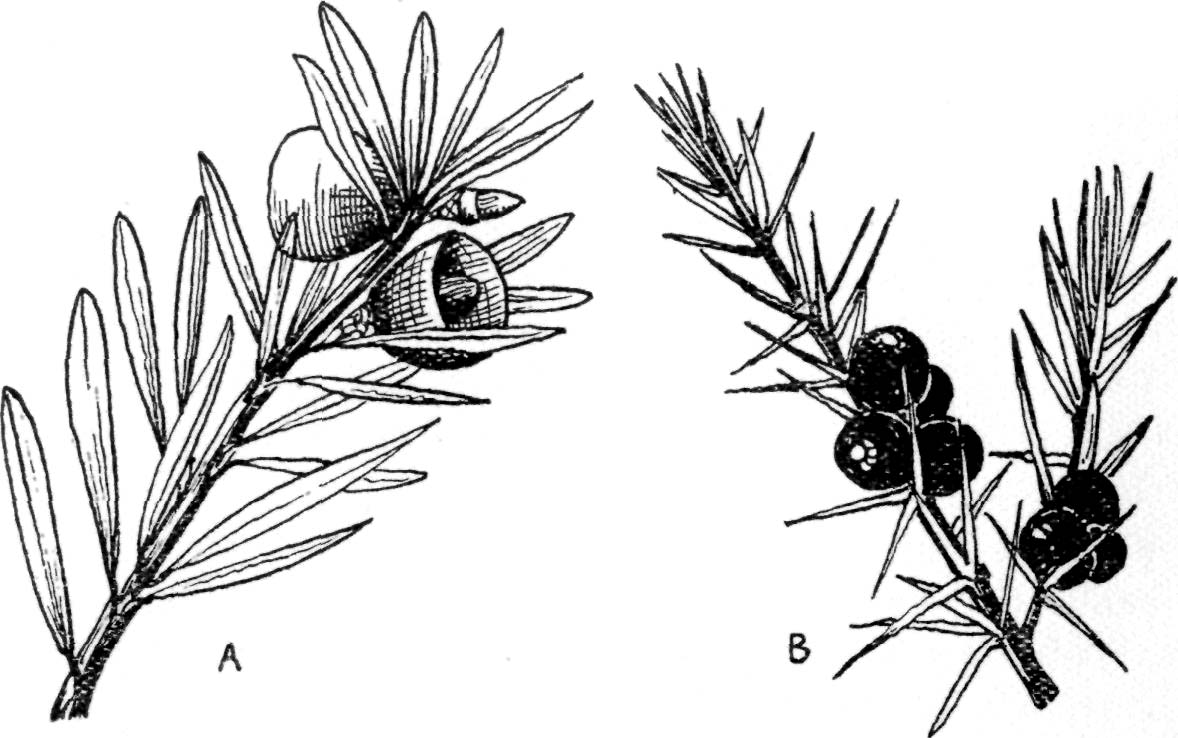
Abb. 3. A Eibe, B Wacholder.
Sehr selten ist sodann der Speierling (Pirus domestica), der der Eberesche äußerlich ähnlich und ihr auch am nächsten verwandt ist.
Die Elsbeere (Pirus torminalis) mit weißdornartigen Blättern besitzt im nördlichen Deutschland nur wenig Standorte, und auch in den übrigen Teilen des Reiches ist sie nur hin und wieder zu finden.
Ein dritter Kernobstbaum, die Mehlbeere, ist zwar etwas häufiger als die beiden vorerwähnten, aber sie hat nicht entfernt die Verbreitung wie die Linde und die Eberesche, von der Eiche und der Fichte ganz zu schweigen.
Deutschland zählt gegen vierzig Baumarten. Sehr reichartig ist es also in dieser Beziehung nicht, besonders wenn man gleichgroße Gebiete derselben Breitengrade in Nordamerika oder im östlichen Asien zum Vergleich heranzieht.

Abb. 4. Elsbeere.
Vor der Eiszeit besaß auch unser Vaterland bedeutend mehr Baumarten, die denselben Gattungen angehörten, wie jene nordamerikanischen und ostasiatischen. Aber die Eiszeit vernichtete bei uns diese Bäume.
So hat denn Deutschland gewiß nicht so viel Ueberfluß an Baumarten, daß es auch nur eine von ihnen gänzlich aussterben lassen dürfte. In neuester Zeit wird daher den gefährdeten Baumarten eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Denn obwohl im allgemeinen das heutige Verhältnis des Menschen zur Vegetation die Mannigfaltigkeit, Ursprünglichkeit und Ausdehnung des Baumbestandes erheblich einschränkt, so fehlt es doch nicht an Bestrebungen, dieser Richtung der Entwicklung einigermaßen entgegenzuarbeiten. Was zunächst die Fürsorge für die selten gewordenen Bäume betrifft, so hat Conwentz in Danzig die Anregung gegeben, daß ihnen von Staats wegen ein Schutz gewährt wird. Dieser Schutz soll sich überhaupt auf alle Bäume erstrecken, die durch ihre Größe, ihr Alter, ihre Geschichte oder aus irgendeinem andern Grunde der Erhaltung wert sind. Für die Provinz Westpreußen speziell hat Conwentz ein „Forstbotanisches Merkbuch” herausgegeben, in dem diese einzelnen Baumindividuen bezeichnet werden. Andere Provinzen und Staaten sind im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. Werden die Forstbeamten alsdann auf die in ihren Revieren stehenden merkwürdigen Bäume aufmerksam gemacht, so wird es in Zukunft verhütet werden, daß sie der Axt zum Opfer fallen.
Ein nicht unbedeutendes Terrain hat sich die Baumwelt in den letzten Jahrzehnten dadurch erobert, daß die zahlreichen neu entstandenen Straßen eine Bepflanzung erforderten. Es hat sich überhaupt die Kenntnis Bahn gebrochen, daß auch Gemeinde- und Feldwege durch die Bepflanzung mit Bäumen bei Nacht und bei Schneewetter an Verkehrswert gewinnen und außerdem einen nicht zu verachtenden Nebengewinn gewähren. In Sachsen ist es neuerdings Vorschrift, auch an Feldwegen Bäume anzupflanzen. An Gemeinde- und Privatwegen finden in günstigen Gegenden meistens Obstbäume ihren Platz, im Süden vorwiegend Kernobst, in Sachsen und Schlesien Kirschen und Pflaumen.
In den warmen Gegenden des südwestlichen Deutschlands war vor einigen Jahrzehnten noch der Walnußbaum häufig anzutreffen, der mit seinen großen Blättern und seiner ausgedehnten Krone herrliche schattige Alleen bildete. Jetzt muß er dem Kernobst mehr und mehr weichen. Der ausschlaggebende Grund ist nach einer Fachzeitschrift im Obstbau derselbe, der auch sonst verschiedene Baumarten in den Hintergrund gedrängt hat: die gegenwärtige Unrentabilität. Die Ernte der Nüsse ist umständlich und gefährlich, dazu haben sie jetzt keinen hohen Preis mehr. Außerdem beeinträchtigt der Baum mit seiner großen Krone und seinen weitziehenden Wurzeln den Ertrag der angrenzenden Felder.
In den norddeutschen Sandgegenden hat die Akazie als Straßenbaum für unchaussierte Wege eine große Bedeutung erlangt. Silberweiden, Schwarz- und Spitzpappeln sind wegen ihres schnellen Wachstums gerade für die Wegränder geeignet, da Bäume im jugendlichen Alter hier immer vielen Gefahren ausgesetzt sind. An den Chausseen kommt mancher Baum zur Geltung, der in den Forsten zurückgesetzt wird, der Ahorn, die Linde, die Eberesche. Auf den Chausseen sieht man nicht nur auf die Rentabilität, sondern auch auf die Stattlichkeit der Bäume.
Das ist auch auf den Straßen innerhalb der Städte der Fall. Nur ist hier die Auswahl in den ungünstigen Luft- und Lichtverhältnissen, unter dem absperrenden Pflaster sehr beschränkt.
Ueberall hat das lebhafte Verlangen nach Eleganz zur Einführung von ausländischen Baumarten geführt. Die einheimischen Lindenarten sind durch die Krimlinde ersetzt worden, die eine schönere Belaubung besitzt und sich auch in den Herbst hinein länger frisch erhält. Der kalifornische Ahorn, der Silberahorn, der ebenfalls aus Nordamerika stammt, die amerikanische Ulme, die größere Blätter besitzt und schneller wächst als die einheimischen Arten, die Scharlacheiche mit ihrer prachtvollen leuchtendroten Herbstfärbung — all diese Baumarten sind häufig an den Chausseen zu sehen.
Eine große Pflege erfährt die Baumwelt in den Parkanlagen und Villengärten, die in den letzten Jahrzehnten in Fülle entstanden sind. Zwar nehmen oft die Villen und Villenstraßen einen Platz ein, an dem vorher eine Baumvegetation stand, aber es sind doch auch viele Villenorte mitten in baumloser Gegend emporgeblüht. In jedem Falle haben die Parkanlagen und Gärten eine große Mannigfaltigkeit in die Baumvegetation gebracht.
Man wird von künstlerischen Standpunkten aus nicht immer mit dieser Zusammenwürfelung von Bäumen aller Arten und aller Länder der gemäßigten Zone zufrieden sein können. Aber das dendrologische (baumkundliche) Interesse hat durch diese Baumwelt der Villengärten und Parkanlagen eine große Förderung erfahren. Welche Menge ausländischer Bäume sind dadurch bei uns eingeführt worden, die nun von jedem Naturfreunde bequem betrachtet und bewundert werden können. Es hat sieh gezeigt, daß die nordamerikanischen Bäume bis weit in den Süden hinein, die Bäume Sibiriens, Chinas und Japans nördlich der subtropischen Zone, ja die des Himalaja, Nordpersiens und einige der südlich gemäßigten Zone bei uns gut gedeihen. So enthalten denn die neueren Parkanlagen viele Hunderte von Baumarten.
Von dieser großen Zahl ausländischer Baumarten sind freilich nur wenige geeignet, sich bei uns vollständig einzubürgern, so wie es mit der Akazie und der Roßkastanie der Fall ist. Es sind schon mehrfach Versuche gemacht worden, die ausländischen Bäume daraufhin zu prüfen, ob sie sich für uns zur Massenanpflanzung, also besonders zur forstlichen Verwendung eignen würden. Die Weymouthskiefer hat sich bereits als ein wertvoller Baum für den deutschen Wald erwiesen. In Bayern wurden unter Leitung von H. Mayr forstliche Anbauversuche mit ausländischen Baumarten angestellt. Als besonders wertvoll erwies sich dabei der abendländische Lebensbaum und die Bankskiefer, beide aus Nordamerika.
Der Lebensbaum eignet sich als Schutzholzart bei Aufforstung von sumpfigen Terrains ebenso wie von dürrem Oedland, da er sowohl außerordentliche Nässe wie große Trockenheit, Hitze wie Kälte gleich gut erträgt.
Für die Aufforstung von dürrsten Sandgegenden ist die Bankskiefer von großer Bedeutung. H. Mayr bezeichnete sie als die wertvollste forstliche Einführung aus Nordamerika während eines Jahrzehnts. Zu derselben Wertschätzung dieser Kiefernart gelangt auch Schwappach, der die in großem Maßstabe in den preußischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche geleitet und ihre Ergebnisse in der „Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen” veröffentlicht hat.
Schwappach hat eine Reihe von ausländischen Baumarten anbauwürdig für den deutschen Wald gefunden. Die amerikanische Esche, die japanische Lärche, den Zuckerahorn, die Roteiche, die Zuckerbirke (Betula lenta) erweisen sich als den entsprechenden deutschen Arten ebenbürtig, in einzelnen Eigenschaften aber als überlegen.
Wertvoll ist außer der bereits erwähnten Bankskiefer die Douglastanne und die Lawsonzypresse, die beide raschwüchsig und nicht empfindlich sind, sodann die spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), die an Raschwüchsigkeit alle deutschen Forstbäume mit Ausnahme der Esche übertrifft und sich auch auf geringem Boden bewährt hat. Sie gibt ein vortreffliches Möbelholz.
Was den Holzwert anbelangt, so ist ihr die schwarze Walnuß noch überlegen. Da dieser Baum wegen seines sehr gesuchten Holzes in Nordamerika fast gänzlich ausgerottet ist, so würde der Anbau in Deutschland lohnend sein. Allerdings können zur Anpflanzung nur milde Gegenden mit gutem Boden in Betracht kommen. Jedenfalls würde der deutsche Wald durch häufigere Anpflanzung dieser ausländischen Holzarten an Mannigfaltigkeit des Aussehens gewinnen, wenn ihm auch die alte Naturmannigfaltigkeit, die Wildheit und Naturwüchsigkeit unwiederbringlich verlorengegangen sind.
III. AUSLÄNDISCHE BÄUME IN DEUTSCHLAND

eutschland war noch zu Cäsars Zeit und selbst einige Jahrzehnte später vielfach ein undurchdringlicher Urwald. Mit dem Fortschreiten der Kultur lichtete sich dieser Wald, bis er jetzt zum größten Teil ausgerodet und, soweit er sich erhalten hat, in Forst umgewandelt worden ist. Es ist gewiß sehr auffallend, daß bei dieser fast vollständigen Ausrodung des Urwaldes kein einziger Baum vollständig verschwunden ist. Denn auf jedem Fleck deutscher Erde, mit ganz verschwindenden Ausnahmen, hat einmal die Holzaxt oder die Säge gehaust. Allerdings sind einige Baumarten, wie die erwähnte Eibe und Elsbeere, die sehr langsam wachsen und sich nur schwach vermehren, so selten geworden und dem Austerben so nahe gebracht, daß sie nur ein besonderer Schutz durch die Forstverwaltung vor dem gänzlichen Erlöschen bewahren kann.
Die Baumwelt Deutschlands hat indessen auch mancherlei Zuwachs aus fremden Ländern und Erdteilen erhalten. Durch den Menschen sind mehrere ausländische Baumarten bei uns eingeführt und zum Teil bei uns eingebürgert worden.
Schon in altgermanischer Zeit hat Deutschland einige sehr wertvolle Bäume so aus dem Ausland erhalten. Unser Hauspflaumenbaum mit blauen, der Kirschpflaumenbaum mit den runden verschiedenfarbigen Früchten und der Sauerkirschbaum stammen nämlich ursprünglich aus dem Orient. Sie wurden von dort durch die Römer nach Italien gebracht, und als in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung römische Kultur in Deutschland eindrang, da hielten auch diese jetzt so allgemein verbreiteten Obstbäume hier ihren Einzug. Und sie haben sich so an unser Klima gewöhnt, daß sie leicht verwildern und sich durch Samen, teilweise auch durch Ausläufer selbst vermehren.
Diese drei Bäume sind so sehr bei uns eingebürgert, daß man sie jetzt als einheimische betrachten kann.
Der wirtschaftliche Wert besonders der Hauspflaume und der Sauerkirsche ist außerordentlich bedeutend, in Mitteldeutschland werden die Gemeindewege sehr oft mit Pflaumenbäumen, in Norddeutschland häufig mit Sauerkirschbäumen bepflanzt. Besonders stattliche Bäume sind beide nicht, in Garten aber machen die Sauerkirschbaume mit ihren wunderbaren blendend weißen Blüten, mit ihren flatternden Hängeästen und ihrem roten Herbstlaub doch in den verschiedenen Jahreszeiten einen recht angenehmen Eindruck.
Auch der Walnußbaum wurde schon früh in Deutschland eingeführt. Auch er ist in Asien und in Persien heimisch und kam von Italien her zu uns. Der Walnußbaum ist ein Freund eines frischen, schweren Bodens, daher ist er in Norddeutschland selten, in Mittel- und Süddeutschland aber in jedem Garten und an vielen Alleen vorhanden. Er ist ein Baum von großer imposanter Schönheit. Der Wert seiner Früchte ist bekannt, und sein Holz ist eins der kostbarsten, die wir besitzen. Er hat sich bei uns ganz und gar eingelebt und wird, da er sehr fruchtbar ist, auch aus unseren Gärten kaum verdrängt werden, obwohl die Walnüsse jetzt schon sehr billig aus Italien importiert werden.
Eine andere Gruppe von Bäumen, die, seit alter Zeit nach Deutschland versetzt, bei uns wegen ihrer Früchte kultiviert werden, haben sich infolge ihrer Empfindlichkeit gegen unser Klima keine so allgemeine Verbreitung verschaffen können. Der Pfirsich, die Aprikose und die Edelkastanie kamen ebenfalls in jenen ersten Zeiten nach Deutschland, als mit der Ausbreitung des Christentums der germanische Urwald sich einigermaßen lichtete und in die Klöster und Klostergärten südländische Kultur einzog. Denn alle drei Baume kamen nicht direkt aus ihrer Heimat, sondern nahmen ebenfalls den Weg über Italien. Pfirsich und Aprikose stammen wiederum aus Mittelasien.
In seiner Gestalt, überhaupt in fast jeder Beziehung, die Früchte ausgenommen, gleicht der Pfirsich dem Mandelbaum.
Allein dieser ist noch viel weniger verbreitet als jener. Während der Pfirsich schließlich in allen Gegenden Deutschlands angebaut werden kann, wenn ihm nur einiger Schutz zuteil wird, kann der Mandelbaum nur in einigen bevorzugten Gegenden des Rheins, der Pfalz und des Elsasses kultiviert werden. Als Zierschmuck wird der Mandelbaum dagegen häufiger in Gärten angepflanzt, ohne indes als solcher eine große Bedeutung zu besitzen.
Die Edelkastanie besitzt auch eine reine lokale Bedeutung, am Rhein und in Süddeutschland wird sie häufiger, in Mitteldeutschland selten, in Norddeutschland nur ausnahmsweise angepflanzt. Auch sie gehört zu den Bäumen, die über Italien bei jener ersten Invasion antiker und christlicher Kultur zu uns kamen. Sie ist aber kein asiatischer Baum, zum mindesten ist ihre Heimat ebensosehr das Mittelmeergebiet. Sie scheint ziemlich früh nach Deutschland gekommen zu sein, denn schon im Jahre 679 wird Küstenholz (Kastanienholz) bei Schlettstadt genannt. In der Pfalz und in Elsaß-Lothringen hat sich die Eßkastanie ganz akklimatisiert, hier wächst sie sogar wild, so daß man anfangs glaubte, sie sei ein einheimischer Baum.
Eigentlich gehört auch der Maulbeerbaum noch zu derselben Gruppe von ausländischen Bäumen. Doch ist seine Bedeutung als früchteliefernde Pflanze recht gering, dagegen besitzt er für die Technik einen ganz eigenartigen Wert. Der Maulbeerbaum kommt bei uns hauptsächlich in zwei Arten, einer schwarzfrüchtigen und einer weißfrüchtigen vor. Beide Pflanzen stammen aus Asien, die weiße speziell aus China. In Italien war nur der schwarze Baum verbreitet und von hier kam er ebenso wie die anderen Kulturbäume nach dem germanischen Norden. Seine Früchte sind weit besser als die des weißen Maulbeerbaumes, dagegen liefert dieser in seinen Blättern das beste und hauptsächlichste Futter für die Seidenraupen. Er wurde erst viel später nach Europa gebracht, nachdem man hier anfing, Seidenzucht zu betreiben. Das geschah erst ums Jahr 1550 in Mailand. 1601 wurde der Seidenbau in Frankreich, viel später, unter Friedrich dem Großen, auch in Preußen eingeführt. Friedrich der Große hat sich viel Mühe gegeben, diesen Erwerbszweig in seinem Lande heimisch zu machen, und die vielen weißen Maulbeerbäume, die in den Kolonien um Berlin damals angepflanzt wurden und zum Teil noch heute stehen, zeugen von den großen Erwartungen, die man auf die Zukunft des Seidenbaues in Norddeutschland setzte. Die Bäume stehen noch, die Seidenzucht ist aber längst verschwunden. Denn die Seidenraupen zeigten sich weit empfindlicher als die Bäume. In der Tat fühlt sich der weiße Maulbeerbaum recht wohl in unserem Klima, nur schade, daß gerade seine Früchte sehr fad und fast widerlich schmecken. Dagegen hat der schwarze Maulbeerbaum weit bessere Früchte, aber gerade er ist viel empfindlicher gegen unser Klima. So kommen denn beide Arten von Maulbeerbäumen bei uns nicht recht zur Geltung, der schwarze nicht, weil er zu empfindlich ist, und der weiße nicht, weil die Zucht der Seidenraupen bei uns mit Schwierigkeiten verbunden ist. Der Maulbeerbaum, dessen Blätter sehr variabel, mitunter ungeteilt, mitunter in der verschiedenartigsten Weise gelappt sind, erreicht eine mittlere Hohe. Er schlägt im Frühjahr ziemlich spät aus; das ist gut für ihn, aber im Frühjahr wirken kahle Bäume nicht sehr freundlich. Im übrigen ist der Maulbeerbaum kein unschöner, aber auch kein besonders hervorstechender Baum.
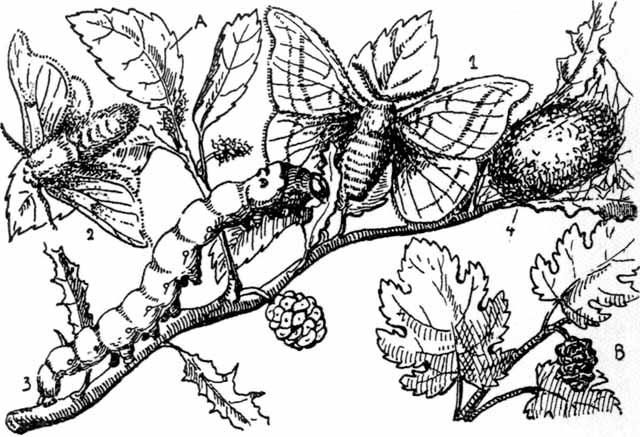
Abb. 5. A Weiße Maulbeere. B Schwarze Maulbeere. 1 und 2 Maulbeerspinner. 3 Raupe. 4 Kokon.
Es ist sehr merkwürdig, daß seit jener althistorischen Zeit Deutschlands kein neuer Fruchtbaum von irgendwelcher Bedeutung bei uns eingeführt worden ist. Es sind ja nachdem manche Bäume mit eßbaren Früchten zu uns gebracht worden, aber keiner ist auch nur so verbreitet, daß sein Name allgemein bekannt wäre. Denn wer kennt schließlich den Lotosbaum, die amerikanischen Wildpflaumen oder die Eberesche mit eßbaren Früchten?
Bezeichnend für die Entwicklung der menschlichen Kultur ist es, daß in frühen germanischen Zeiten nur Nahrungsbäume zu uns gelangt sind. Ueber die Stillung des Appetits reichte das Interesse für die Baumwelt anscheinend noch nicht hinaus. Doch wollen wir zum Lobe unserer biederen Altvordern annehmen, daß sie wahrscheinlich auch irgendeinen ausländischen Arzneibaum angepflanzt hätten, wenn sie einen hätten ausfindig machen können. Und es ist fast wunderbar, daß ihnen das nicht gelungen ist, denn was sie an Arzneikräutern zusammengetragen haben, das ist gerade keine kleine Menge.
Erst in der Neuzeit sind wieder Bäume zu uns gekommen, die zwar keine eßbaren Früchte liefern, aber dafür mancherlei andere Bedeutung besitzen. Die wertvollsten von ihnen sind die Roßkastanie und die Akazie.
Die Roßkastanie wurde in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts nach Deutschland gebracht.
Sie verbreitete sich von Konstantinopel aus, doch ist ihre ursprüngliche Heimat nicht bekannt. Sie hat sich bei uns vollständig eingebürgert und ist jetzt unzertrennlich mit menschlicher Ansiedlung verbunden. Obgleich sie sich durch Samen selbst fortpflanzt, so verwildert sie doch bei uns nicht eigentlich. Auf freiem Felde, im Walde, selbst am Waldrande wird man sie kaum treffen. Ohne Zweifel bedarf sie der Begünstigung des Menschen, um emporzuwachsen. Der Same, durch Kinder verschleppt, keimt an irgendeinem Zaune, in einem verlorenen Winkel des Hofes oder Gartens, dort wächst sie in die Höhe und wird schließlich bemerkt und, wenn ihr das Schicksal günstig ist, vor das Haus an die Straße gepflanzt. Das ist die Geschichte der meisten Kastanienbäume, die es in deutschen Landen gibt. Es ist immer nur ein Schönheitsbedürfnis oder der Ausfluß einer stillen Naturliebe, wenn jemand eine Roßkastanie pflanzt; denn einen eigentlichen Wert hat der Baum nicht, sein Holz taugt nicht viel, es ist schwammig und fault leicht, und die Früchte werden auch selten verwendet. Daß die Blüten den Bienen eine reichliche Nahrung geben, ist auch nur ein Nebenvorteil, um dessentwillen kaum eine Roßkastanie angepflanzt werden würde. Denn als Bienenweide würden andere Pflanzen mehr in Betracht kommen. Als Zierbaum dagegen hat die Roßkastanie sehr wertvolle Eigenschaften. Sie ist stattlich, gravitätisch und imposant wie kaum ein anderer Baum. Ihr Stamm ist dick und ihre Krone gleicht einer mächtigen kugelrunden Halle. Die siebenfingerigen Blätter haben bei ihrer Größe eine steife feierliche Würde, so wie sie die Bauern bei Festaufzügen lieben. Das Laubdach, wohl dichter noch als es der Walnußbaum hat, hält die heiße Sommersonne von den Fenstern des Hauses ab, vor dem es steht, es läßt auch den Regen nicht so schnell durch.
Im Frühling macht sich die Kastanie sehr bald
bemerklich. Im März schon schwellen die Knospen zur
Kirschengröße an und leuchten, von einem klebrigen Harze
umkleidet, in der Sonne. Im April werden die Knospen immer gewaltiger,
und sie entfalten die ersten Laubfinger viel früher, als die
meisten Bäume ihr Laubkleid anziehen. Mit der Birke zusammen
kündet die Roßkastanie den Eintritt des Vollfrühlings
an. Bald nachdem der erste zartgrüne Laubschmuck erschienen ist,
tauchen die schönen weißen Blütenkerzen auf, die ebenso
vornehm würdevoll aussehen wie der ganze Baum. Gegen den Herbst zu geben die
Früchte den Kindern wochenlang eine stete Unterhaltung, sie sind
ein schönes, unschuldiges Spielzeug, und wenn es auch vorkommt,
daß die Jungen sich die Kastanien gegenseitig an den Kopf werfen,
so schadet das weder den Früchten noch den Köpfen. Die
Roßkastanie besitzt auch eine schöne Herbstfärbung,
mitunter sind es ganz prachtvolle braune Töne,
mitunter auch ist es ein weniger auffälliges Gelb.
Abb. 6. Roßkastanie. So ist denn die Roßkastanie ein Zierbaum ersten
Ranges, sie ist eine Art Volksbaum geworden, den jeder kennt und an dem
jeder seine Freude hat. Auch die Akazie hat viele Eigenschaften, die sie zum
Zierbaum geeignet macht, aber sie ist dabei auch ein höchst
nützlicher Baum. Speziell für das große norddeutsche
Flachland hat sie eine sehr große Bedeutung gewonnen, und sie ist
hier nach der Kiefer ohne Zweifel der verbreitetste Baum. Die Akazie ist noch etwas später nach Deutschland
gekommen als die Roßkastanie. Ihre Heimat ist Nordamerika. Der
Gärtner Heinrichs IV. von Frankreich brachte im Jahre 1600 den
Baum von Virginien nach Paris. Von hier aus hat sich dieser auch nach
Deutschland verbreitet. Die Akazie hat die treffliche Eigenschaft, noch in
leichtem, dürrem Sande zu gedeihen, und sie besitzt ein sehr
schnelles Wachstum. Sie eignet sich daher vorzüglich als
Straßenbaum auf Sandwegen. Zwar macht sie viele und sehr dornige
Wurzelschößlinge, die sich weithin verbreiten und eventuell
mitten im Wege aus der Erde hervorschießen. Aber durch diese
Schößlinge kann sie auch leicht vermehrt werden. Es ist
nicht die Art der niederdeutschen Landleute, Bäume sorgfältig
heranzuziehen, um sie dann zur Anpflanzung an den Gemeindewegen zu
benutzen. Aber die Akazie drängt sich mit ihren häufigen
Schößlingen, die in zwei Jahren schon kleine Bäumchen
geworden sind, geradezu auf. Ausgraben muß er die
Schößlinge doch, damit sie ihm in Hof und Garten nicht
hinderlich werden, und wenn er sie einmal ausgegraben hat, so ist der
Schritt bis zur Anpflanzung an den Feldwegen nicht mehr ganz so weit.
Der Verkehr auf diesen öden, baumlosen Sandfluren wird aber durch
die Straßenbäume, zumal in der Nacht und bei Schnee,
bedeutend sicherer. Die Akazie wird bald ein großer Baum, der
immerhin so viel Schatten gibt, daß in seinem Bereich der Weg
nicht so sehr dörrt, sondern das Gedeihen einer den Sand
befestigenden Vegetation gestattet. Die Akazie liefert auch ein gutes, festes, haltbares
Holz, das zu den verschiedensten Zwecken benutzt werden kann. Der Baum
wird denn auch vielfach forstlich angebaut, die Akazie wird aber mehr
noch als wegen ihres Nutzens zur Zierde angepflanzt. Die Dörfer
des norddeutschen Flachlandes sind voll von Akazien &mdash Häufig genug
sind nicht nur die Dorfstraßen, sondern auch größere
Plätze mit Akazien bewachsen. Ueberall, in Gärten, auf
Kirchhöfen, auf verwildertem Lande machen sie sich breit. Die
Akazie ist leider gar kein Frühlingsbaum und auch kein Herbstbaum.
Sie ist noch kahl und dunkel, wenn schon längst das frische
Maigrün überall hervorgebrochen ist. Erst zur Zeit, wo auch
die Pappeln sich belauben, nach der zweiten oder gar dritten
Woche des Mai, streckt auch die Akazie ihre
Fiederblätter hervor. Die Belaubung selbst ist allerdings sehr
schön, sie ist sehr zierlich da die einzelnen Blättchen der
Blattfiedern sehr klein sind. Wir haben nur sehr wenige Bäume mit
gefiederten Blättern, und keiner von ihnen hat das zarte,
liebliche Laub der Akazie. Eine wunderbare Pracht aber kommt über den Baum,
wenn zu Beginn des Juni die großen weißen
Blütentrauben erscheinen. Das luftige Grün mit dem blendenden
Weiß vereint gibt Farbentöne von unendlicher Zartheit. Der
Duft, der von den Blüten ausgeht, ist freilich schwerer, er ist
schwül und berauschend wie der des Jasmins. Die Dörfer der
Mark sind zur Blütezeit der Akazien erfüllt von diesem
berauschenden Duft, in schwülen Gewitternächten wird er
aufdringlich und förmlich beängstigend. Die Akazien bleiben
im Herbste ziemlich lange grün, zumal wenn der Frost lange
ausbleibt. Aber die Blätter verfärben sich gewöhnlich
nicht, sie werden immer unansehnlicher und schrumpfen zusammen, bis
schließlich die Fiedern abfallen. Mitunter trägt der Baum
schon früh im Herbst eine solche Menge von rötlichschwarzen
Hülsen, daß diese ihm ein fremdartiges, nicht besonders
zierendes Aussehen verleihen. Die Hülsen bleiben den Winter
über hängen, der Wind setzt sie in Bewegung, so daß sie
einander treffen. Dann geht von dem Baum ein surrendes Geräusch
aus, das sich mit den Windstößen und Windpausen
verstärkt oder vermindert. Die Akazie hat einen sehr auffälligen Stamm. Lange,
stark hervortretende Längswülste, die sich bald kreuzen, bald
vereinen, bringen in der Rinde eine sehr eigenartige Zeichnung hervor,
an der man den Baum auch im unbelaubten Zustande schon von weitem
sofort von jedem anderen unterscheiden kann. So allgemein wie die Akazie und die Roßkastanie
ist späterhin kein Baum wieder verbreitet worden. Allerdings
erfreuen sich diese beiden auch einer ganz besonderen Beliebtheit. Es gibt aber immerhin noch einige später
eingeführte Bäume, die man auch ziemlich häufig
antrifft. In Vorgärten und auf Kirchhöfen wird der schon
erwähnte Lebensbaum außerordentlich häufig angepflanzt. Es gibt zwei Arten dieses
dunkeln, steifen, düsteren Nadelbaumes. Der morgenländische
Lebensbaum, der übrigens wohl nicht nur artlich, sondern sogar der
Gattung nach von seinem Namensvetter verschieden ist, kam aus
Zentral- und Ostasien zu uns. Er ist etwas empfindlicher als der
abendländische Lebensbaum, der aus Nordamerika stammt. Der
letztere fühlt sich bei uns ganz einheimisch, und da er sich von
dem asiatischen in der Gestalt nur recht wenig unterscheidet, so wird
er von den beiden am häufigsten angepflanzt. Er ist sehr
anspruchslos, so wie es ein Baum sein muß, der
Volkstümlichkeit erlangen will. Der Lebensbaum ist das Symbol der
Trauer. Die düstere Unbeweglichkeit seiner schuppenförmigen
Nadeln, die steif emporstrebenden Aeste, die lang-pyramidenförmige
Gestalt, die Düsterkeit seiner Belaubung geben dem Baum etwas
ungemein Ernstes und Trauervolles. Auch die Pyramidenpappel ist fast überall
verbreitet; in Sachsen z. B. findet man fast kein Dorf, in dessen
Nähe sich nicht einige Exemplare dieser Baumart befänden. In
Norddeutschland ist sie seltener, überhaupt findet man sie nicht
mehr so häufig wie früher, da jetzt die Mahnung an alle
Landleute ergangen ist, Obstbäume anstatt der Pappeln zu pflanzen,
die noch dazu durch ihre weitlaufenden, flachgehenden Wurzeln das
anliegende Feld aussaugen. Die Pyramidenpappel wurde erst gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts nach Deutschland gebracht. Sie stammt aus
Italien. Abgesehen von ihrer äußeren Gestalt gleicht sie
unserer Schwarzpappel genau. Viele halten sie daher nur für eine
Abart dieses Baumes. Wie dem auch sei, jedenfalls macht die
Pyramidenpappel oder, wie sie auch heißt, Spitzpappel einen ganz
andern Eindruck. Diese schmale, säulenartige Gestalt hat etwas
unsäglich Feierliches. Eine Allee von Spitzpappeln, eine lange
gerade Reihe vor einem Schlosse macht den Eindruck gewaltiger
Größe und Vornehmheit, sie lenkt den Blick in die
Vergangenheit und läßt den Boden, auf dem sie steht, als den
Schauplatz gewaltiger historischer Ereignisse erscheinen. In der
Gestalt der Zypresse ähnlich, erweckt sie doch nicht die Vorstellung des
Melancholischen, die wir mit dieser verbinden. Die Spitzpappel hat
trotz aller Steifheit immer noch etwas Freundliches, zumal ihre
Blätter, wie bei allen Pappeln, selten ganz ruhig verharren.
Gleich den übrigen Pappeln schlägt auch die Pyramidenpappel
erst spät im Mai aus, und auch im Herbst besitzt sie nichts
Anziehendes. Aber diese einzige säulenförmige Gestalt sichert
ihr einen besonderen Platz in der Baumwelt Deutschlands. Die Pyramidenpappel wächst sehr schnell empor. Doch
ist ihr und auch unserer Schwarzpappel eine amerikanische Art, die
kanadische Pappel, weit überlegen. Sie kam etwa zu derselben Zeit wie ihre italienische
Verwandte nach Deutschland. Aus Nordamerika, dem Wunderland der
Bäume, brachte sie all das Riesenhafte, Schnellebige mit, das
diesem Erdenstück eigen ist. Die Kanadapappel wächst
unglaublich schnell in die Höhe. In ein paar Jahren ist sie ein
hoher Baum geworden, in fünfzehn bis zwanzig Jahren hat sie eine
Stärke erreicht, wie sie eine Eiche kaum in zweihundert Jahren
erlangt. Sie hat etwas sehr Ungeschlachtes. Ihre Krone besteht aus
wenigen Aesten, die sich, fast unverzweigt, sehr lang hinausstrecken.
Daher hat diese Laubkrone nicht die Fülle der Linde oder
Roßkastanie, sie ist vielmehr zerrissen und spendet keinen tiefen
Schatten. Alte Bäume wirken ja durch ihren kolossalen Stamm immer
malerisch, aber im ganzen hat die kanadische Pappel wenig Zierwert.
Dagegen eignet sie sich wegen ihrer Schnellwüchsigkeit gut zum
Straßenbaum, auch wird sie häufig als Platzfüller in
jungen Anlagen angewandt, um später, nachdem die schöneren
Bäume nachgewachsen sind, wieder entfernt zu werden.
Schnellwüchsig wie sie ist, liefert sie sehr bald eine große
Menge von Holz, und da dieses zur Anfertigung verschiedenartiger
landwirtschaftlicher Geräte gut benutzt werden kann, so besitzt
der Baum einen nicht zu unterschätzenden Wert. Noch eine andere ausländische Pappelart wird in
Deutschland nicht selten angepflanzt, die Silberpappel. Sie stammt aus dem Süden und Südosten Europas.
In Italien und Griechenland wächst sie häufig wild, aber
auch in Asien ist sie weit verbreitet. Auch sie ist sehr
schnellwüchsig und wird ebenfalls bald ein großer,
breitstämmiger Baum. Ihre Zweige und die Unterseite ihrer
Blätter sind mit einem weißen Filz überzogen, so
daß der Baum ganz weiß leuchtet. Die Blätter sind
überdies sehr schön ahornartig gelappt und besitzen auf der
Oberseite einen lebhaften schwarzgrünen Glanz. So hat die
Silberpappel ein sehr dekoratives Ausschen; bei älteren
Bäumen geht allerdings das leuchtend weiße Haarkleid etwas
zurück. Man findet die Silberpappel in Parkanlagen sehr
häufig, aber obwohl sie ein sehr schöner, auffälliger
Baum ist, hat sie doch nicht die Bedeutung der beiden anderen
ausländischen Pappeln zu erreichen vermocht. Von den Zierbäumen, die schon vor längerer
Zeit eingeführt worden sind, spielt noch die Trauerweide eine
hervorragende Rolle. Linné hat sie babylonische Weide genannt, weil er
meinte, sie sei der Baum gewesen, unter dem ehemals die Juden
während ihrer Gefangenschaft „an den Wassern Babylons
saßen und weinten”. Indes soll dieser Baum eine Pappel gewesen
sein, jedenfalls war es nicht unsere Trauerweide, denn diese kommt in
Babylon gar nicht vor. Sie stammt vielmehr aus Ostasien, aus Japan und
China. Aus dem ostlichen Asien scheint sie nach Südeuropa gebracht
und dann von hier in der ersten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts auch in die nördlicheren Lander eingeführt
worden zu sein. Nach England scheint sie zunächst gekommen zu sein. Ueber ihre Einführung dort existiert eine sehr
anmutige Geschichte. Lady Suffolk, eine Freundin Popes, des
berühmten englischen Kritikers, der auch ein großer
Naturfreund war, erhielt aus Spanien — nach einer andern Lesart
aus der Türkei — einen Korb, der aus Weidenruten geflochten
war. Pope, der gerade bei der Dame zu Besuch war, untersuchte den Korb
nicht auf seine Schönheit oder sonst irgendeine Eigenschaft,
sondern daraufhin, ob wohl die Weidenruten noch grün und lebendig
wären. Wirklich fand er noch einige der Zweige in voller
Lebenskraft, und nun wurde eine Rute gepflanzt. Aus ihr ging die
Trauerweide hervor. Popes Name machte diese Trauerweide überall
bekannt. Fremde besuchten sie vielfach, und von ihr sollen alle
Trauerweiden abstammen, auch die, die später in Deutschland
angepflanzt wurden. Der spätere Eigentümer des Gartens, in
dem die Weide stand, ließ zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
das Exemplar umhauen. Offenbar weniger natur- und menschenfreundlich,
ärgerte er sich über den zahlreichen Besuch von Fremden, die
Popes Trauerweide zu sehen begehrten, und machte so auf gewaltsame
Weise dem Andrang der Fremden und dem historischen Baume ein Ende. Jedenfalls trug Popes Name viel dazu bei, die
Trauerweide zu verbreiten, denn auch in Deutschland war der Name des
englischen Kritikers, der sich zuerst von der Tradition der
französischen Klassiker abwandte und Natur auch in der Kunst
predigte, sehr bekannt. Ein anderer Umstand trug dazu bei, der Trauerweide eine
gewisse Berühmtheit zu verleihen. Auf der Insel St. Helena stand
eine schöne Trauerweide, die der englische Gouverneur mit anderen
Gehölzen dahin verpflanzt hatte. Napoleon I. besuchte die Weide
häufig, und später, nach seinem Tode, pflanzte die Pflegerin,
Madame Bertrand, von diesem Baume Zweige um sein Grab. Daher wird die
babylonische Weide häufig auch Napoleonsweide genannt. Die Trauerweide ist ein Baum von wunderbar malerischem
Aussehen. Sie ist ein schöner, großer Baum, dessen schlanke,
lange Zweige in elegantem Bogen überhängen. Dieses schlaffe,
aufgelöste Herabhängen der Zweige erweckt zwar das
Gefühl stiller Wehmut, aber es liegt über den lichten Aesten
und den langen, schmalen Blättern doch auch eine
hoffnungerweckende Freundlichkeit.

Abb. 7. Friedhof mit Lebensbäumen und Trauerweide.
Im übrigen hat die Trauerweide alle Vorzüge ihrer Gattung. Sie wächst schnell, pflanzt sich leicht durch Ruten und Setzstangen fort, schlägt früh im Jahre aus, und zur Zeit der Blüte, gegen Ende April, bekommt sie durch ihre zahlreichen Kätzchen noch einen besonderen Schmuck. Die Trauerweide wird vielfach auf Kirchhöfen angepflanzt, man sieht sie aber auch in Parkanlagen und selbst hier und da an Wegen. Früher wurde sie jedoch noch häufiger angepflanzt als jetzt. In den letzten Dezennien hat man von vielen Bäumen Trauerformen hervorgesucht oder gezüchtet. Es gibt, wie ein geistvoller Gartenbauschriftsteller jüngst sagte, ungemein viel Trauriges in den heutigen Gärten. Wir haben jetzt eine Traueresche, eine Trauersophore, einen Trauererbsenbaum, sogar einen Trauerapfel.
Ueberhaupt ist durch das zahlreiche Aufblühen von Villen und Villenkolonien, durch die Pflege des städtischen Parkbaues das Bedürfnis nach aparten Bäumen rege geworden. Jeder Parkdirektor, jeder Villenbesitzer möchte womöglich etwas Schöneres in seinem Garten haben als der andere. Dieser Neigung zum Effektvollen, diesem Bemühen um das Auffälligere kam nun die Leichtigkeit des modernen Verkehrs sehr zustatten, der die Bäume aller Länder ohne Schwierigkeit nach Deutschland brachte.
In dem letzten halben Jahrhundert sind ungeheuer viel fremdländische Bäume in unsere Gärten gekommen. Wenige haben sich indes so bewährt, daß sie eine größere oder allgemeine Verbreitung gefunden hätten. Viele werden angepflanzt, weil der Park oder Garten nun einmal nicht aus simpeln deutschen Bäumen bestehen darf. Das würde vielen zu billig und daher verdächtig erscheinen, obwohl sie sicher keine ausländische Esche, Birke, Ulme von einer deutschen unterscheiden können. Mehrere Bäume indes, die sich wirklich auffällig von unseren abheben, stellen entweder besondere Anforderungen, die nicht immer erfüllt werden können, oder sie sind den Baumschulbesitzern noch nicht hinreichend bekannt und sind deshalb noch nicht genügend verbreitet. In der Fülle des Angebotenen kommt auch mitunter das Bessere nicht auf, während eine mit viel Reklame angebotene Baumart häufiger an den Mann gebracht wird. Dazu herrscht jetzt die leidige Gewohnheit, auf künstlichem Wege Bäume mit auffälligen Formen, mit bunten, gelbgeränderten oder geschlitzten Blättern, mit abnormen Blüten usw. zu erzielen. Solche Spielereien, an denen die Züchter viel Geld verdienen, sind jetzt sehr beliebt, während man es sich weniger angelegen sein läßt, die Baumwelt fremder Länder in ihren natürlichen Formen kennenzulernen und anzupflanzen.
Unter den wirklich wertvollen Bäumen, die ziemlich häufig verbreitet sind, nehmen amerikanische Ahornarten einen hervorragenden Platz ein.
Der schönste ist der Blutahorn, aus Nordamerika stammend, der im Frühjahr mit seinen roten Blüten einen prachtvollen Eindruck macht.
Wegen seiner Schnellwüchsigkeit und Anspruchslosigkeit ist auch der aus Kalifornien eingeführte Eschenahorn sehr verbreitet, der, abweichend von den meisten Vertretern seiner Gattung, gefiederte Blätter hat.
Wie der Eschenahorn, so wirkt auch der Silberahorn (auch seine Heimat ist Nordamerika) durch die Eleganz seines Laubes. Doch besitzt der letztere außerdem eine weißliche oder mehr bläuliche Farbe auf der Unterseite seiner Blätter, und das gibt dem Baume noch ein besonders apartes Aussehen.
Der Silberahorn führt seinen Namen nicht ganz mit Recht, mit so weißem Filze bedeckte Blätter wie die bereits erwähnte Silberpappel hat überhaupt kein anderer bei uns gedeihender Baum. Immerhin trägt die Silberlinde — es gibt eine Art aus Ungarn und eine aus Nordamerika — schon eher ihren Namen mit Recht. Auch bei ihr sind die Unterseiten der großen Blätter weißlich. Solche Bäume mit unterseits weißlichen Blättern sehen besonders dann prunkvoll aus, wenn der Wind die Blatter bewegt und womöglich die Sonne auf die Unterseiten scheint.
Bäume von wunderbarer Pracht sind die Magnolien; bei uns werden allerdings die meisten strauchartig gezogen. Die weißen Riesenblüten, die vor den Blättern erscheinen, geben diesen Pflanzen, die teils in Amerika, teils in Japan zu Hause sind, ein wahrhaft tropisches Aussehen.
Seit längerer Zeit schon werden die Platanen, die orientalische sowohl wie die amerikanische, in Deutschland angepflanzt.
Es sind schöne, stattliche Bäume, deren Stamm dadurch eine besondere Zierde bekommt, daß er große Rindenstücke abwirft und infolgedessen weißgesprenkelt aussieht.
Durch zierliche Blütenfülle und Blütenpracht zeichnen sich mehrere ausländische Apfelbaumarten, besonders einige aus China und Sibirien stammende Wildäpfel, aus, beliebt ist auch der mehr strauchartig wachsende Essigbaum mit seinen braunroten Frucht-Sträußen und seinen schönen, großen Fiederblättern, die im Herbste sich herrlich rot färben.
Wegen ihres prachtvollen roten Herbstlaubes werden auch einige nordamerikanische Eichenarten häufiger angepflanzt, die Scharlacheiche, die Sumpfeiche und die Roteiche.
Die Roteiche gehört zu den wenigen neuen ausländischen Baumarten, die auch um ihres praktischen Nutzens willen bei uns kultiviert werden. Es sind eigentlich in den neuen Einführungen nur drei Arten, die in größerem Umfange auch forstlich angebaut werden: Die Roteiche und noch weit mehr die schon erwähnte Weymouthskiefer und ganz neuerdings die Douglastanne. Die Roteiche wurde 1760 in Deutschland eingeführt. Ihre Blätter gleichen denen unserer Eichen weniger, da sie sehr tiefe Einschnitte besitzen.
In Amerika ist das Holz dieser Bäume außerordentlich geschätzt, bei uns übertrifft es jedoch das ihrer einheimischen Verwandten nicht. Allein die Roteiche wächst viel schneller, darum wird sie bereits seit etwa hundert Jahren an verschiedenen Stellen Deutschlands forstlich angebaut. Die Schnellwüchsigkeit ist es auch hauptsächlich, welche der Weymouthskiefer und der Douglastanne in manchen Bodenarten das Uebergewicht über unsere einheimische Kiefer und Tanne respektive Fichte gibt.
Die Weymouthskiefer, die auch aus Nordamerika stammt, ist bereits seit Beginn des achtzehnten Jahrhunderts in Europa bekannt, aber erst nach und nach ist sie weiter verbreitet worden. Sie übertrifft die gemeine Kiefer besonders auf etwas besserem Sandboden, hier ist sie außerordentlich raschwüchsig, sie gedeiht aber überhaupt auf jedem Boden und erträgt auch Beschattung durch andere Bäume sehr gut, so daß sie zu Mischpflanzungen verwandt werden kann. Sie beschattet auch selbst den Boden viel mehr als die gemeine Kiefer und verbessert den Boden dadurch außerordentlich. Das Holz ist leicht, aber haltbar. Es läßt sich sehr bequem bearbeiten und wird deshalb in der Möbeltischlerei zu Schiffs-, Waggon- und Zimmerauskleidung und zu manchen anderen Zwecken benutzt.

Abb. 8. A Weymouthskiefer. B Gemeine Kiefer.
In neuerer Zeit wird der Douglastanne, deren Herkunft das nordwestliche Nordamerika ist, große Aufmerksamkeit geschenkt. Sie ist weit anspruchloser als unsere Fichte und Edeltanne, ist auch noch unempfindlicher gegen Kälte und Trockenheit und wächst dabei mit gewaltiger Schnelligkeit heran. In Preußen wurde sie schon vor einiger Zeit auf dreihundert Morgen Land, die in den verschiedensten Teilen lagen, versuchsweise angebaut, und diese Versuche haben bis jetzt die glänzendsten Resultate ergeben. Auch in den übrigen Teilen Deutschlands und in Oesterreich hat man dieselben günstigen Erfahrungen mit der Douglastanne gemacht, so daß diese ohne Zweifel in kurzer Zeit eine weite Verbreitung finden wird.
Es sind von den vielen hundert Baumarten, die in Deutschland eingeführt worden sind, schließlich nur ganz wenige, die sich bei uns eingebürgert haben, und auch nicht viele, die bei uns eine größere Beliebtheit erlangt haben. Immerhin ist durch sie unsere Baumwelt, die ja an und für sich arm an Arten ist, in nennenswerter Weise bereichert worden. Unsere Wälder und Forsten bestehen zwar fast nur aus einheimischen Arten, aber die menschlichen Ansiedlungen, die Parkanlagen und Straßen sind ohne auslandische Bäume gar nicht mehr denkbar. Eine Menge der wertvollsten Fruchtbäume, die beliebtesten Zierbäume sind aus dem Auslande zu uns gekommen, und die besten von ihnen sind schon seit Jahrhunderten in Deutschland, so daß wir sie ganz zu den unseren zählen können.
IV. NEUE FRUCHTGEHÖLZE IN DEUTSCHLAND

eit Jahrhunderten hat sich in Deutschland kein neuer Baum oder Strauch eingebürgert, dessen Früchte für den Menschen genießbar wären.
Unsere bekannten Obstgehölze, die wir vom Ausland bekommen haben, Pflaumen und Sauerkirschen, Pfirsiche und Aprikosen, der Walnußbaum, der Weinstock, sind bereits im Altertum und im frühesten Mittelalter zu uns gebracht worden. Sie sind wohl alle über Italien zu uns gekommen; die Mönche, welche die römische Kultur im inneren Germanenlande verbreiteten, pflanzten in den Klostergärten die kostbaren Fruchtgewächse an, und von diesen Gärten aus nahmen die fremdländischen Obstgehölze ihren Weg über das ganze Land. Der Weltverkehr steigerte sich in dem Jahrhundert der Entdeckungen außerordentlich, aber zur Bereicherung unserer Obstgärten hat er nichts beigetragen. Amerika wurde entdeckt und lieferte uns die Kartoffel, den Mais und den Tabak, aber Baum oder Strauch mit eßbaren Früchten hat es uns nicht geschenkt, nur das südliche Europa verdankt ihm den Feigenkaktus. Die umfangreiche Obstzucht, die in Amerika jetzt betrieben wird, gründet sich auf unsere Obstarten: Apfel, Birne, Pflaume, Pfirsich und Aprikose.
Bei der Ausdehnung und Leichtigkeit des Weltverkehrs kann es nicht wundernehmen, daß unzählige Arten von Pflanzen fremder Länder und Erdteile zu uns gebracht worden sind. Von ihnen führen aber die meisten ein stilles, wenig beachtetes Dasein in den Gewächshäusern und Freilandbeeten der botanischen Gärten. Ein nicht unerheblicher Teil ausländischer Gewächse wird als Schmuckpflanzen in Parkanlagen und Privatgärten verwendet, einige sind sogar in den einfachsten Bauerngarten und in die Stube des Arbeiters gedrungen.
Unter diesen Gewächsen befinden sich eine Fülle von Bäumen und Sträuchern, die bei uns gut im Freien gedeihen, aber keiner darunter besitzt eßbare Früchte, so daß sich sein Anbau lohnte.
Erst in neuester Zeit hat man versucht, ausländischen Gehölzarten mit eßbaren Früchten eine größere Verbreitung zu verschaffen. Dieser Versuch verdient Beachtung, auch wenn sich keine dieser Pflanzen eine allgemeine Beliebtheit erwerben sollte. Hier und da mochten sich Liebhaber für sie finden, wie für die Tomate und die Artischocke. Mancher möchte auch etwas Interessantes und Apartes in seinem Garten haben, und in diesem Falle wäre eine Anpflanzung der neuen Fruchtgehölze zu empfehlen.
Vor einer Reihe von Jahren wurden japanische Pflaumen bei uns bekannt, die große, schmackhafte Früchte trugen. Sie erschienen in mehreren Sorten und kamen über Nordamerika zu uns. Nun fehlt es bei uns zwar nicht an Pflaumensorten, aber diese japanischen Pflaumen stammen von anderen Arten ab als unsere europäischen.
Denn die Gattung der Pflaumen — Prunus — umfaßt nicht nur unsere Hauszwetsche und Kriechelpflaume, sondern auch Süß- und Sauerkirsche (Prunus avium und Prunus cerasus), ferner die Aprikose (Prunus armeniaca). In dem Schlehdorn haben wir in Deutschland auch eine Wildpflaume.
In anderen Ländern und Erdteilen gibt es nun weit mehr Wildpflaumenarten, Amerika und das östliche Asien besitzen davon eine Menge. Während aber unser Schlehdorn nur kleine, roh kaum zu genießende herbe Früchte liefert, geben verschiedene amerikanische Wildpflaumenarten ein schmackhaftes Obst. Die Japaner, die große Gartenkünstler sind, haben ihre in der Natur wildwachsenden Pflaumenarten oder vielleicht auch nur eine Art, die sich gut dazu eignete, in Zucht genommen und sie so veredelt, wie wir unseren wilden Apfelbaum. Die bei uns eingeführten japanischen Pflaumensorten scheinen fast alle von der dreiblütigen Pflaume (Prunus triflora) abzustammen, die in Ostasien weit verbreitet ist. Darum haben diese Obstbäume oder Obststräucher — denn sie haben einen buschartigen Wuchs — auch ein anderes Aussehen als unsere Pflaumen. Sie bilden lange dünne Zweige, gleich wie der Pfirsich, und ähneln ihm auch im Laub. Ihre Blätter sind länglich, nicht rund, und haben eine hellgrüne Färbung wie die Blätter der Weiden. Im Frühjahr sind diese japanischen Pflaumen reich mit Blüten besetzt und bilden dann einen schonen Schmuck für jeden Garten. Allein die japanischen Pflaumen tragen auch Früchte, die von Kennern gerühmt werden. Von unseren Pflaumen sind diese Früchte im Geschmack sehr verschieden. Sie erinnern an den Pfirsich, übrigens sind auch bei ihnen die verschiedenen Sorten durchaus nicht gleich. Wie bei uns Hauspflaume, Reineclaude und Mirabelle sehr verschiedenen Geschmack besitzen, so ist dieses auch bei den einzelnen Sorten der Japaner der Fall. Die Früchte sind meist herzförmig, spitz, ihre Haut ist in der Regel gelb oder rot, ihr Fleisch gelb. Bei einer Sorte, welche Satsuma oder Blutpflaume heißt, ist das Fleisch dunkelrot, so dunkel wie bei keiner anderen blutfarbigen Obstsorte.
Von allen japanischen Pflaumensorten hat sich die Botanpflaume bei uns am meisten bewährt. Ihre fast runde, glänzende dunkelkirschrote Frucht hat ein weiches, saftiges, süßes und wohlschmeckendes Fleisch. Sie reift Mitte August. Wie alle japanischen Pflaumen, hält auch die Botan unseren Winter aus, sie ist sehr fruchtbar und macht keine größeren Ansprüche an den Boden als unsere alten eingebürgerten Pflaumen.
Erwähnt sei noch die Sorte Burbank. Sie ist, wie schon ihr Name sagt, keine reine japanische Sorte mehr. Denn Burbank ist einer der ersten Pflanzenzüchter Nordamerikas, dem die Vereinigten Staaten schon manche edle Obstsorte verdanken. Er hat auch durch Kreuzung der Japaner mit amerikanischen Sorten die nach ihm benannte Pflaume gezüchtet. In Amerika, besonders in Kalifornien, hat man überhaupt die japanische Pflaume mit großem Eifer aufgenommen, an dreißig Sorten sollen dort kultiviert werden. Schon vor einem Menschenalter gelangten die japanischen Pflaumen nach Amerika, sie haben also erst ziemlich spät den Weg zu uns gefunden. Wahrscheinlich lag das daran, daß man sie für zu empfindlich für unser Klima hielt. Wenn jetzt diese Obstpflanzen, nachdem ihr Gedeihen in Deutschland und der Wohlgeschmack ihrer Früchte von ersten Autoritäten anerkannt worden sind, trotzdem in weiteren Kreisen noch unbekannt sind, so mag das an der Langsamkeit liegen, mit der sich Neuheiten auf pflanzlichem Gebiete bei uns Bahn brechen. Vielleicht auch daran, daß wir genügend Pflaumensorten von verschiedenstem Geschmack besitzen. Freilich wird auch von ihnen außer den Zwetschen keine Sorte allgemein angebaut; Reineclauden, Mirabellen, Eierpflaumen finden sich, abgeschen von einigen bevorzugten Obstgegenden, meist nur in den Gärten der Liebhaber.
Nächst den japanischen Pflaumen sind die amerikanischen Brombeeren die wertvollste Einführung an Fruchtgehölzen der jüngsten Zeit. Auch sie sind in mehreren Sorten zu uns gekommen. Sie entstammen einer in Nordamerika wildwachsenden Brombeerart (Rubus villosus), der zottigen Brombeere, deren Blätter an der Unterseite einen weißen Haarüberzug tragen. Die amerikanischen Sorten, die dieser wilden Art entstammen, haben im allgemeinen zwar das Aussehen unserer Brombeeren mit schwärzlichen Früchten, wie sie an Waldblößen, Waldrändern, an Rainen und Abhängen allenthalben in Deutschland sich finden. Aber die amerikanischen Brombeeren sind nicht ganz so dornig und haben einen schlankeren Wuchs, sie ranken leicht in die Höhe und können als Klettersträucher zur Bedeckung von Wänden und Zäunen benutzt werden. Sie blühen in weißen Rispen, und ihre Fruchtbarkeit ist überaus groß, sie übertreffen darin die besten unserer einheimischen Arten. Ihre Früchte sind größer und haben einen besseren Geschmack. Unsere einheimischen Brombeeren gelten nicht für feineres Beerenobst, da sie einen seifigen und kratzigen Nachgeschmack haben. Die Amerikaner haben dagegen einen milderen, edleren Geschmack. Von allen Sorten hat sich die New-Rochelle- oder Lawton-Brombeere bei uns am besten bewährt und ist daher auch in neuester Zeit öfters bei uns gepflanzt worden. Vor vielen Jahren sind diese amerikanischen Beerensträucher schon zu uns gelangt, aber erst seit den letzten Jahrzehnten in den Kreisen der Gartenfreunde bekanntgeworden. Ueber diese hinaus geht ihre Verbreitung auch heute noch nicht.
Vor etwa einem Jahrzehnt kam noch eine andere Rubusart mit eigenartigen Früchten aus Japan zu uns und wurde als japanische Weinbeere angepriesen. Daß sie eine Brombeerart sei, wurde möglichst verschwiegen, und so träumte mancher Gartenbesitzer schon von einem niederen Strauch, an dem etwas wie Weintrauben hingen. Diese japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius) ist ein Strauch von der Höhe eines Meters und gleicht äußerlich dem viel angepflanzten wohlriechenden Himbeerstrauch, der durch seine großen roten Blüten sehr dekorativ wirkt. Im Wuchse dagegen, in dem Aussenden schlanker, langer Ruten ähnelt sie mehr unseren Brombeeren. Ihre Früchte haben eine schöne kirschrote Farbe und sind von großem Wohlgeschmack. Damit wäre dem neuen Strauch eine große Verbreitung gesichert, allein er besitzt einen schlimmen Fehler, er ist nämlich nicht ganz winterhart. Wenn er unbedeckt bleibt, erfriert er leicht. Nun ist es zwar für jeden Gartenbesitzer leicht, den Strauch mit Tannenreisig, Wacholderzweigen oder einem anderen Material zu bedecken, aber die Erfahrung zeigt immer wieder, daß in Deutschland eine Pflanze, mag sie noch so schön oder interessant sein, ja selbst materiellen Gewinn versprechen, keine allgemeine Aufnahme findet, wenn sie nicht völlig anspruchslos ist und gleichsam wie das Unkraut wuchert. Die Rosen sind fast die einzigen Pflanzen, die man allgemein vor Winterkälte zu schützen gelernt hat. Die japanische Weinbeere ist nun lange nicht so frostempfindlich wie eine Tee- oder Noisetterose, aber sie verlangt doch Aufmerksamkeit und dauernde Pflege.
Von größerem Nutzen für manche Gegenden Deutschlands könnten die amerikanischen Moosbeeren werden, die auch erst in neuerer Zeit bei uns bekanntgeworden sind. Auf mit Moosen bewachsenen Hochmooren finden wir bei uns häufig die Torfbeere, eine Schwesterart der Heidel- und Preiselbeere, eine kleine Pflanze, deren holzige Stengel, mit zierlichen, immergrünen Blättern besetzt, über und zwischen dem Moose hinlaufen. Im Herbste bedecken sich die Pflanzen mit schönen knallroten preiselbeergroßen Früchten, die eingemacht fast ebensogut wie Preiselbeeren schmecken. Die amerikanischen Moosbeeren sind nun in allen Teilen größer, besonders auch in ihren Früchten und tragen deren auf günstigem Boden eine bedeutende Fülle. Der günstigste Boden ist aber eben ein Land, das sonst für Pflanzenkultur fast unbrauchbar ist, ein mooriges, torfiges, sumpfiges Terrain, wie es in Norddeutschland vielfach gefunden wird. Hier würde die Moosbeere, ohne Pflege zu beanspruchen, vorzüglich gedeihen und den Moorländereien einen gewissen Wert verleihen. Man kann diese amerikanischen Moosbeeren auch im Garten in feuchtem Lande kultivieren, doch ist Gartenland im allgemeinen zu kostbar für eine solche Pflanze.
Ein eigenartiger neuer Fruchtstrauch ist die eßbare Oelweide (Elaeagnus longipes). Sie gehört nicht zur Gattung der Weiden, wie man nach ihrem Namen annehmen könnte, sondern ist eine zu den Seidelbastgewächsen gehörige Pflanze und steht als solche der Ordnung der Rosenblütler und damit auch unseren Kern- und Steinobstgewächsen am nächsten. Aeußerlich gleicht sie ihnen jedoch sehr wenig. Sie ist ein leichtgebauter kleiner Strauch mit hübschen länglichen Blättern. Im Mai erscheinen an ihm eine Fülle hellgelber Blüten, die einen angenehmen Wohlgeruch verbreiten. Am schönsten nimmt sich der Strauch aus, wenn er im August mit reifen Früchten dicht behangt ist. Diese Früchte haben etwa die Größe von Kirschen, eine bräunlich rote Färbung, und ihr Geschmack ist angenehm. Sie können auch zu Beerenwein Verwendung finden und geben ein vorzügliches madeiraartiges Frühstücksgetränk. Der aus Japan stammende Strauch ist so schön, daß er auch als Ziergehölz in jedem Garten angepflanzt werden könnte.
Noch sind in letzter Zeit mancherlei andere Fruchtgehölze eingeführt oder ihrer Früchte wegen empfohlen worden. So die mährische Eberesche mit süßen Früchten, eine Abart unserer gewöhnlichen Eberesche; die Büffelbeere (Shepherdia) aus Nordamerika und die großfrüchtige Hagebutte (Rosa rugosa) aus Japan. Aber der Wert ihrer Früchte ist lange nicht so groß wie der der vorerwähnten Fruchtgehölze. Diese verdienen jedenfalls allgemeinere Aufmerksamkeit. Da Deutschland nicht reich an Fruchtpflanzen ist, wäre die Einbürgerung von neuen derartigen Gewächsen zu wünschen. Unsere Heimat ist aber auch nicht einmal reich an Baum- und Straucharten, und die hier erwähnten Gehölzarten zeichnen sich fast alle durch besondere Schönheit aus. So wäre ihre Verbreitung in Deutschland in doppelter Beziehung ein Gewinn.
V. EINWANDERUNG DER GETREIDEARTEN IN DEUTSCHLAND

ie Mehrzahl der Kulturpflanzen, deren wir uns heute erfreuen, stammt aus fernen Ländern, aus fernen Erdteilen. Nach und nach kamen sie zu uns, bürgerten sich bei uns ein und gestalteten die Physiognomie unserer Flora in gewaltiger Weise um. Keine andere Gruppe unserer Kulturpflanzen aber kann sich an Bedeutung mit den Getreidegräsern messen. Sie sind es, die den größten Teil unseres Vaterlandes bedecken und die wichtigsten Nahrungsmittel der Europäer liefern. Sie sind es auch, auf die sich der Ackerbau in Deutschland hauptsächlich erstreckt. Von den Getreidearten stammt vielleicht nur eine einzige aus dem heutigen Deutschen Reiche, alle anderen kamen von außerhalb, einige von ferneren Erdteilen.
Auch die edelste unserer deutschen Getreidearten, der Weizen, hat seine Heimat nicht in Europa. Es ist noch nicht vollständig gelungen, die Herkunft und Geschichte dieser Pflanze, die so eng mit der Kultur und dem Leben der Völker verbunden ist, genau aufzuklären. Es steht aber unzweifelhaft fest, daß schon die ältesten Völker den Weizen kannten und ihn anbauten.
Die Chinesen haben ihn nachweislich schon zweitausendsiebenhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung kultiviert, und auch bei den alten Aegyptern reicht der Anbau bis ins dritte vorchristliche Jahrtausend zurück.
Die ältesten Dokumente für die Kultur des Weizens in europäischen Ländern finden wir in den Hinterlassenschaften der Pfahlbautenbewohner. So hat man in den Ablagerungen der Schweizer und italienischen Seen, deren Bodengrund gleichsam ein blattweise aufgeschichtetes Herbarium der Vorzeit ist, auch den Weizen inmitten anderer damals vorhandener oder verfertigter Produkte der jüngeren Steinzeit gefunden. Auch hier kann man auf ein Alter von über tausend Jahren vor unserer Zeitrechnung schließen.
So verliert sich denn die Geschichte des Weizens bis in die älteste historische Zeit. Wir können indes seine Spuren noch weiter verfolgen.
Die ältesten Sprachen der Welt selbst geben uns einigen Aufschluß über das ungeheuer hohe Alter des Weizenbaues. Das Chinesische, das Sanskrit, diese uralte indische Sprache, die die älteste Sprachstufe der indogermanischen Sprachgruppe darstellt, ferner das Hebräische und das Aegyptische enthalten ein Wort für Weizen. Aber sie enthalten keineswegs dafür ein Wort, das auf einen gemeinsamen Stamm zurückgeht. Während im Gegensatz hierzu das Wort Weizen — im Gotischen z. B. hwaitei, im Isländischen hveite, im Englischen wheat geheißen — in allen germanischen Sprachen auf denselben Stamm zurückgeht, und während man aus dieser Tatsache schließen muß, daß der Weizen allen germanischen Völkern bereits bekannt war, als sie noch zusammenlebten und genau dieselbe Sprache besaßen, lautet der Name für Weizen in allen alten Kultursprachen verschieden.
Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Kultur des Weizens ganz außerordentlich alt sein muß. Er ist von keinem der alten Völker einem anderen gegeben worden, denn das importierte fremde Gut behält den Namen, den es bei dem importierenden Volke besitzt.
Die verschiedene Bezeichnung für den Weizen wäre am einfachsten so zu lösen, daß jedes der alten Kulturvölker selbständig auf den Anbau des Weizens verfallen wäre. Dabei ist aber vorauszusetzen, daß der Weizen sich überall in den Ländern als wilde Pflanze vorgefunden hätte, in denen jene Völker wohnten. Nun ist aber der Weizen weder in China, noch in Indien, noch in Europa, noch in Aegypten in wildem Zustande aufgefunden worden. Und hier gelangen wir nun zu einem Ergebnis, das nicht nur für die Geschichte des Weizens, sondern für die Geschichte der ältesten Kulturmenschheit überhaupt von unermeßlicher Bedeutung sein könnte.
Vom Weizen ist nur eine Abart bisher in unkultiviertem Zustande entdeckt worden. Diese kommt in Kleinasien und Mesopotamien noch heute vor. Ja, sie verbreitet sich sogar über Griechenland bis nach Serbien, reicht also ein Stück in das europaische Gebiet hinein. Schon antike Schriftsteller, unter anderen Berosus, der ein Zeitgenosse Alexanders des Großen war, geben an, daß der Weizen in Mesopotamien, ja auch im westlichen Indien wildwachsend vorkomme. Wie ist es aber möglich, daß von hier der Weizen nach dem fernen Osten kam, nach China, das durch weite Steppen und hohe Gebirge vom westlichen Asien abgetrennt ist?
Es deutet sehr vieles darauf hin, daß der wilde Weizen früher weiter östlich vorgekommen ist und sich erst später nach dem Abendlande zu ausgebreitet hat, und daß andererseits die Chinesen in Zentralasien nahe jenem Hindukusch-Hochlande gewohnt haben, das schon so oft als die Wiege des Menschengeschlechts bezeichnet worden ist. Der berühmte Geograph von Richthofen hat darauf hingewiesen, daß Chinesen und abendländische Völker gewisse astronomische Vorstellungen gemeinsam besitzen, und er hat daraus gefolgert, daß beide Völkergruppen einst nahe beieinander in Zentralasien gewohnt haben.
Die gemeinsame Pflege der Weizenkultur macht nun ebenfalls diese ehemalige Nachbarschaft wahrscheinlich.
Daß aber der Weizen früher nicht in Westasien, sondern in Zentralasien wild gewachsen sei, hat erst vor kurzem der Graf zu Solms-Laubach als wahrscheinlich hingestellt. Nach der Eiszeit fand eine große Einwanderung zentralasiatischer Pflanzen nach Kleinasien und dem südöstlichen Europa statt. Unter diesen Pflanzen hat sich höchstwahrscheinlich auch der Weizen befunden. Seine ursprüngliche Heimat, das ist der Schluß von all diesen und noch mehreren anderen Erwägungen, war das zentrale Asien. Hier nahmen ihn die verschiedenen, damals noch nahe beieinander wohnenden Völker in Kultur. Das mag in jener alten grauen Zeit gewesen sein, wo der Mensch noch kaum einer vollentwickelten Sprache fähig war. Der Weizen wurde von all diesen zentralasiatischen Völkerschaften angebaut, während für ihn keine gemeinsame Bezeichnung, vielleicht überhaupt keine Bezeichnung existierte. Erst später, als diese Völker ihre eigenen Sprachen ausbildeten, gab jedes dem Weizen einen Namen. Und diese Namengebung erfolgte vielleicht erst dann, als die Völker von Zentralasien hinwegwanderten, die Chinesen nach Osten, die Arier in der Hauptsache nach Europa. Alle diese arischen Völkerschaften brachten nun den Weizen in die Lander, in denen sie sich niederließen, die Griechen nach Griechenland, die Italiener nach der Apenninenhalbinsel, die Kelten nach dem westlichen Europa. Vielleicht waren es diese bereits, die den Weizen in dem heutigen Deutschland zum erstenmal anbauten. Denn die Germanen zweigten sich erst ziemlich spät von der großen arischen Völkerfamilie ab. Sie mußten Deutschland zum großen Teile den Kelten erst wieder abnehmen, ehe sie sich hier dauernd niederlassen konnten. So sind wohl nicht sie, sondern die Kelten, jenes einst so machtige und jetzt nur noch in wenigen Ueberresten in Frankreich und England erhaltene Volk, die ersten gewesen, die Weizen auf deutschen Boden bauten *).
*) Die hier überall zugrunde gelegten Anschauungen von der Einwanderung der europäischen Kulturvölker aus Asien unterliegen gerade im Augenblick wieder sehr lebhaften wissenschaftlichen Debatten, deren Ergebnis noch aussteht. Die mitgeteilten botanischen Einzeltatsachen werden davon doch kaum berührt.
Eine Abart des Weizens, die in Süddeutschland nicht selten kultiviert wird, ist der Spelt oder Dinkel. Er unterscheidet sich von den gewöhnlichen Weizensorten dadurch, daß seine Körner bei der Reife nicht aus den Spelzen herausfallen, sondern diese als umhüllende Schale, ähnlich wie der Hafer, dauernd behalten.
Der Spelt wird in den Denkmälern der ältesten Kulturvölker nicht erwähnt, er besitzt auch in deren Sprachen keinen Wortstamm. Dagegen kannten ihn die Griechen und die Römer sehr wohl, und schon in den Homerischen Gesängen wird er sehr häufig erwähnt.
Vielleicht haben die Germanen diese Getreidefrucht überhaupt erst aus dem Süden erhalten. Es ist auffällig, daß eine Weizensorte mit gespelzten Körnern in jenen ältesten Sprachen und Sprachdenkmälern nicht erwähnt wird. Denn gerade jene Weizenart, die heute noch in Kleinasien wildwachsend vorkommt, und ehemals ihre Heimat in Zentralasien gehabt haben muß, besitzt Körner mit bleibenden Spelzen. Vielleicht sind deshalb unsere heutigen gewöhnlichen Weizensorten nur Kulturformen, die aber bereits in jenen urältesten Zeiten gezüchtet wurden.

Abb. 9. Getreidearten der Pfahlbauzeit.
(Von links: Kolbenhirse, Fennich, kleiner Pfahlbauweizen, zwei sechszeilige Gersten, ägyptischer Weizen, Emmer und Rispenhirse. Nach O. Heer.)
Ebenso wie der Weizen ist auch die Gerste schon in den allerältesten Zeiten der Menschheitsgeschichte angebaut worden. Auch sie ist als wilde Pflanze in Asien gefunden worden, und zwar weit im Osten dieses Erdteils. Die alten zentralasiatischen Völker konnten sie von hier nach allen Teilen der Welt verbreiten. So war die Gerste auch schon bei den Aegyptern in Kultur. Die indogermanischen Volksstämme besitzen für die Bezeichnung dieser Getreideart eine gemeinsame Sprachwurzel. Es geht daraus unbedingt hervor, daß diese Völker die Gerste schon besaßen, als sie noch eng beieinander in Zentralasien wohnten und ein einheitliches Volk mit einer gemeinsamen Sprache bildeten. Bei dem Zuge der Arier nach dem Westen wurde die Gerste auch nach Deutschland gebracht. In der Schweiz und den oberitalienischen Seen finden wir sie schon in einer Zeit, wo die Metalle noch unbekannt waren. Das Volk der Pfahlbauten, das wahrscheinlich ein keltisches war, mag sie schon damals auf das Gebiet des heutigen Deutschlands herübergetragen haben. Die Germanen, die ihrerseits den Anbau der Gerste schon von ihrer asiatischen Urheimat her kannten, kultivierten die Pflanze weiter. Der römische Schriftsteller Tacitus, der im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte, schilderte die Germanen zum erstenmal ausführlich seinen Landsleuten und erwähnt dabei diese Tatsache ausdrücklich. Er erzählt auch, daß die Germanen schon damals aus der Gerste ein berauschendes Getränk zu brauen verstanden, und er verschweigt auch nicht, daß sie diesem Gerstengetränk bereits damals in ausgiebigster Weise huldigten. Früher stand die Gerste als Nahrungsmittel für den Menschen viel höher als heute, wo sie nur noch in der Form von Graupen gegessen, im übrigen aber als Viehfutter verwendet wird. Es gibt drei Abarten von Gerste. Je nach der Art und Weise, wie die Aehrchen an der Aehrenspindel gruppiert sind, unterscheidet man zweizeilige, vierzeilige oder gemeine und sechszeilige Gerste. Wildwachsend hat man nur die zweizeilige gefunden. Die vierzeilige wird erst bei Theophrast erwähnt, einem griechischen Naturforscher, der im Jahre 287 vor unserer Zeitrechnung starb. Die beiden anderen Gerstenarten dagegen wurden von alters her angebaut. Da wir aber nur die zweizeilige Gerste als wilde Pflanze kennen, so müssen wir auch hier annehmen, daß die anderen Formen erst in der Kultur entstanden sind, und zwar die sechszeilige schon im Anfang des Ackerbaues, während die vierzeilige, die in den ägyptischen Denkmälern und in den Pfahlbauten fehlt, wohl erst später aufgetreten ist.
Bedeutend jünger als der Anbau des Weizens und der Gerste ist derjenige des Roggens. Den alten asiatischen Kulturvölkern war er noch nicht bekannt. Wir finden von ihm keine Spur, weder in den Schriften der alten Chinesen, noch in den Kulturdenkmälern der Aegypter. Auch weder in den semitischen Sprachen noch im Sanskrit findet sich für diese Pflanze eine Bezeichnung. Die indogermanischen Völkerstämme kannten ihn also noch nicht, als sie in Zentralasien noch zusammenlebten. Aber auch in den Schweizer Seen ist er weder in der Steinzeit noch in der Bronzezeit gefunden worden. Zum erstenmal erwähnt wird der Roggen von dem römischen Schriftsteller Plinius, der im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte. Er berichtet, daß die Getreidepflanze am Abhange der Alpen angebaut werde. Etwas später hören wir, daß auch in Mazedonien und Thrazien, also in der heutigen südlichen Türkei, Roggen kultiviert werde. Vorher erwähnt aber kein griechischer Schriftsteller diese Pflanze, die sicher den Griechen bekannt gewesen wäre, wenn sie schon vorher in Mazedonien und Thrazien, den Nachbarländern des alten Griechenlands, angebaut worden wäre. Demnach tauchte höchstwahrscheinlich damals erst diese Pflanze vom Norden her auf.


Roggen. Abb. 10. Zweizeilige Gerste.
So ist denn der Roggen weder von Asien noch von Südeuropa nach Deutschland gekommen, wie die beiden vorher erwähnten Getreidearten und so viele andere Kulturpflanzen. Der Roggen tritt vielmehr während der Blütezeit Roms an den Schweizer Seen auf. Sodann aber weist das Vorkommen von Bezeichnungen für Roggen in den alten germanischen, slawischen und keltischen Sprachen darauf hin, daß die in das mittlere und nördliche Europa vorgedrungenen Arier hier den Roggen zum erstenmal anbauten. Ohne Zweifel müssen sie also diese Getreideart erst in ihrer neuen Heimat kennengelernt haben. Mit diesem Umstand stimmt es vorzüglich überein, daß der Roggen in Oesterreich sehr leicht verwildert, daß er also hier am besten die Lebensbedingungen vorfindet, die er früher im Naturzustande gehabt hat. Einen Fingerzeig für den ursprünglichen Wohnbezirk des Roggens gibt aber vor allem die Tatsache, daß Abarten dieser Getreidepflanze in den Gegenden zwischen den österreichischen Alpen und dem Kaspisee, also besonders in Südrußland, noch im unkultivierten Zustande verbreitet sind. Hier also ist jedenfalls die Heimat unseres Roggens gewesen. Der arische Völkerstrom, der sich nach Griechenland und Italien ergoß, konnte deshalb den Roggen nicht in Anbau nehmen, vielmehr mußte diese Pflanze den Griechen und Römern erst bei der Berührung mit nördlicher wohnenden Völkern bekanntwerden. Die Kelten, Slawen und Germanen, die sich nach dem nördlicher gelegenen Teile Europas wandten, wurden hier auf diese wichtigste Nahrungspflanze Mitteleuropas aufmerksam. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß sie etwa den Anbau des Roggens bei der alten Urbevölkerung Europas, wenn es eine solche überhaupt gab, kennengelernt haben. Denn sonst würde auch vor der Römerzeit Roggen in den Pfahlbauten-Ueberresten der Schweizer Seen gefunden worden sein. Die Germanen und ihre keltischen und slawischen Nachbarn, die alle vorzügliche Ackerbauer waren, erkannten vielmehr selbst den Wert des Roggens, sie kannten ihn wahrscheinlich noch nicht sehr lange, etwa ein oder zwei Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. So kann der Roggen, wenn man sich nicht so streng an die Grenzen des heutigen Reiches hält, immerhin als deutsche Pflanze bezeichnet werden. So erklärt es sich auch leicht, daß der Roggen in Deutschland am wenigsten empfindlich ist von allen Getreidearten, er säet sich leicht von selbst aus, und er übersteht unseren Winter vorzüglich, während Weizen nur in den milderen Gegenden unseres Vaterlandes angebaut werden kann. Damit hängt es auch zusammen, daß in Deutschland zum Brotbacken fast ausschließlich Roggen verwendet wird und dieser infolgedessen als unsere wichtigste Getreidepflanze bezeichnet werden muß.
Wenn dem Weizen in ihrer Geschichte die Gerste nahesteht, so gleicht dem Roggen darin in vielen Beziehungen der Hafer. Auch diese Getreidepflanze hat nicht den Ruhm, in den alten Büchern und Denkmälern der orientalischen Völker erwähnt zu werden. Weizen und Gerste verdanken das hohe Alter ihrer Kultur der asiatischen Heimat, der Roggen aber und der Hafer sind abendländische Pflanzen, und wie das Abendland erst spät in der Geschichte eine Rolle spielt, nachdem im Osten schon seit Jahrtausenden menschliche Kultur ihre unvergänglichen Urkunden aufgezeichnet hatte, ebenso gelangten auch diese beiden Getreidearten erst ziemlich spät in den Besitz der Menschheit. So findet sich denn kein Wort für Hafer, weder in den asiatischen Sprachen, noch im Aegyptischen. Ja selbst die Griechen und sogar die Römer der alten republikanischen Zeit kannten den Hafer noch nicht. Diese Getreidepflanze, die uns heute zur Fütterung der Pferde so unentbehrlich scheint, ist den alten griechischen und römischen Rossen nie zu Gesicht gekommen, obwohl sie es an Kriegstüchtigkeit wie an friedlicher Zug- und Lastarbeit doch wohl noch immer mit einem Berliner Droschkengaul aufgenommen haben würden.

Abb. 11. Hafer.
Die erste schriftliche Nachricht von dieser in der gesamten Pferdewelt der Erde epochemachenden Getreidepflanze stammt wieder von dem römischen Schriftsteller Plinius. Etwa um seine Zeit haben die Römer, die ihre Pferde mit Gerste fütterten, wahrscheinlich den Hafer erst von den Germanen kennengelernt. Allzulange mochten damals aber auch diese den Anbau dieser Getreideart noch nicht betrieben haben. Denn in den Ueberresten der schweizerischen Pfahlbautenkultur lassen sich Körner erst in der Bronzezeit nachweisen. Aehnlich wie es mit dem Roggen der Fall war, so wurde wohl auch der Hafer von den arischen Stämmen, die diesseit der Alpen wohnten, schon einige Jahrhunderte lang vor unserer Zeitrechnung angebaut. Welches von diesen Völkern, ob Kelten, Germanen oder Slawen, den Hafer zuerst angebaut hat, das läßt sieh natürlich nicht mehr entscheiden. Es ist selbst möglich, daß alle drei sehr bald unabhängig voneinander die Brauchbarkeit dieser Getreideart kennengelernt haben. Denn der Hafer, das scheint ziemlich sicher, muß in den Ländern, in denen jene Stämme wohnten, seine ursprüngliche Heimat haben. Eine Grasart mit so großen Körnern mußte natürlich den arischen Stämmen, welche bereits den Anbau des Weizens und der Gerste kannten, sehr bald auffallen und ihnen sofort zu einem regelmäßigen Anbau geeignet erscheinen. Daß der Hafer von Anfang an in Deutschland heimisch war, darauf deutet auch die Fähigkeit dieser Getreidepflanze hin, bei uns ohne Hilfe des Menschen längere Zeit ihr Fortkommen zu finden oder auch gänzlich zu verwildern.
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer sind weitaus die wichtigsten Getreidearten, die gegenwärtig auf deutschem Boden angebaut werden. Früher nahmen auch die Hirse und der Buchweizen ein nicht unbedeutendes Stück unserer heimischen Erde in Anspruch. Die Hirse ist eine uralte Kulturpflanze, deren Anbau sich in das graue Dunkel der Urgeschichte verliert wie der des Weizens. Die asiatischen Kulturvölker kannten sie ebenso wie die alten Aegypter und die Bewohner der Schweizer Pfahlbauten. Wahrscheinlich stammt sie also aus Asien, von wo sie die arischen Volker frühzeitig nach dem Abendlande brachten. Die Hirse gedeiht auf Sandboden, deshalb hatte sie in Norddeutschland ein nicht ungünstiges Gebiet für ihre Kultur. Allein ihr Anbau ist bei uns doch nicht sehr lohnend, und seit der Einführung der Lupine und der Anwendung des künstlichen Düngers werden auch sandige Felder in den geeigneten Zustand gebracht, um wenigstens alle zwei Jahre eine befriedigende Ernte des weit lohnenderen Roggens zu geben.

Abb. 12. Weizenarten.
1 Bartweizen. 2 Spelt. 3 Kolbenweizen. 4 Einkorn. 5 Emmer.
Aus demselben Grunde wird auch der Buchweizen immer mehr verdrängt, der ehemals in Norddeutschland eine ungeheure Verbreitung besaß. Der Buchweizen ist eine der wenigen Getreide-Pflanzen, die nicht zur Familie der Gräser gehören, sondern dem Geschlechte der Knöteriche nahe verwandt sind, die auf unseren Wiesen und Fluren in vielen Formen vorkommen. Der Buchweizen ist ganz im Gegensatz zur Hirse eine ziemlich moderne Kulturpflanze. In Europa ist er erst zum Ausgang des Mittelalters bekanntgeworden. Seine Heimat ist das nordöstliche Asien; im östlichen Sibirien und in der Mandschurei wächst er wild. Von hier hat sich das Gebiet seiner Kultur allmählich westlich nach Rußland und Deutschland ausgedehnt, und um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts wird er zum erstenmal in unserem Vaterlande als Getreidepflanze erwähnt. Er gehört also zu den jüngsten Getreidearten, aber trotz seiner Jugend berechtigt er doch nicht zu großen Hoffnungen, wenigstens nicht in Deutschland. Der Buchweizen, der auch Heidekorn genannt wird, lieferte besonders früher den Bewohnern armer Sandgegenden die nahrhafte Heidegrütze. Uebrigens rührt der Name Buchweizen von der Achnlichkeit her, welche die Körner der Pflanze mit den dreikantigen Früchten der Rotbuche besitzen. Mit dem Weizen, dieser edelsten und anspruchsvollsten Getreideart, hat er dagegen sehr wenig Berührungspunkte. Weit charakteristischer für ihn ist der Name Heidekorn. Aber auch der Heideboden wird der Pflanze, wie gesagt, mehr und mehr entzogen, seitdem er in höhere Kultur gebracht ist und der verfeinerte Geschmack der Landbewohner an der ehrwürdigen Buchweizengrütze nicht mehr viel Gefallen findet.
Nicht viel jünger als die Einführung des Buchweizens in Deutschland ist die des Maises. Der Mais ist die einzige Getreidepflanze, die uns das große und in weiten Strecken uns klimatisch nahestehende Amerika gegeben hat. Doch von dieser so wichtigen Pflanzengruppe der Getreidearten gibt es so wenige, daß jede einzelne einen unermeßlichen Schatz für das Menschengeschlecht bedeutet. Leider ist für Deutschland der Wert des Maises nicht allzu bedeutend. Dagegen wird er in den südeuropäischen Ländern in großen Mengen angebaut, hier werden seine Körner auch zu einem schneeweiß aussehenden Brote verarbeitet. Nach dem Süden Europas ist denn auch der Mais zunächst gekommen, als er von Amerika importiert wurde. Denn in den warmen Ländern gedeiht der Mais ungleich viel besser als in Deutschland. Im Süden werden seine Körner jedes Jahr reif, und da der Mais einen außerordentlich hohen Ertrag liefert, so erklärt es sich, daß er dort vielfach den Weizen verdrängt hat. Als Amerika entdeckt wurde, fand man den Mais bereits in Kultur. Seine eigentliche Heimat sind die innerhalb der Wendekreise gelegenen Teile von Amerika. Aber er ist schon seit alten Zeiten überall in diesem Erdteil angebaut worden.
In den Denkmälern der alten amerikanischen Kulturvölker, z. B. der hochbegabten Inkas, sind Andeutungen und Spuren der Maiskultur vielfach aufgefunden worden. Nach der Entdeckung von Amerika gelangte der Mais nach Europa. Etwa vom Jahre 1520 an wurde er nun regelmäßig in Spanien und von 1560 an in Italien angebaut. Von den südlichen Ländern erhielt dann später auch das südliche Deutschland die amerikanische Getreidepflanze. Auf die Einführung aus den südeuropäischen Landern deuten auch die Namen hin, die der Mais vielfach im Volksmunde führt: Welschkorn oder türkischer Weizen. Dagegen ist Mais der ursprüngliche Name, mit dem die Peruaner die Pflanze bezeichnen. In Süddeutschland bereits ist der Mais als Getreidepflanze nicht mehr lohnend genug, daß ihm weite Landstriche eingeräumt werden könnten. Da der Mais südlicher Gegenden jede deutsche Konkurrenz schlägt und diese Getreideart kein Brot liefert, das dem deutschen Gaumen sonderlich zusagt, so liegt auch kein besonderer Ansporn zur Maiskultur vor. Dies gilt jedoch nur für den Mais als Getreide, denn als Futterpflanze hat er sich im verflossenen Jahrhundert weite Strecken des mittleren und nördlichen Deutschlands erobert. Wie als Getreide, so übertrifft der Mais auch als Grünfutter lieferndes Gewächs jede andere deutsche Pflanze. Während er aber die erstere Eigenschaft nur in südlichen Ländern äußert, zeigt er die letztere auch bei uns in überraschendem Maße. So wird denn diese Getreideart bei uns vielfach im großen angebaut, ohne indes Getreidekörner zu liefern.
Alle unsere Getreidepflanzen können auf eine Kultur von langen Jahrhunderten, die meisten sogar auf eine solche von vielen Jahrtausenden zurückblicken. Bei mehreren der Getreidearten reicht der Anbau bis in die ersten Anfänge der Geschichte, ja bis weit in die prähistorische Zeit zurück. Und dies kann nicht wundernehmen, denn erst von dem Zeitpunkt an, wo der Mensch Pflanzen — und dies waren Getreidearten — anzubauen lernte, erst da wurde er aus einem rohen Jäger oder einem vagabundierenden Nomaden ein gesitteter Mensch, der sich an Recht und Gesetz band. Es ist kein Zufall, daß der Name Kultur von einem Wortstamm herrührt, der das Anbauen von Pflanzen bezeichnet. Noch heute gebraucht der Landmann, der Gärtner, der Förster das Wort Kultur in dem alten Sinne. Und sie haben recht. Denn beide Begriffe hängen aufs engste miteinander zusammen: erst der Anbau des Getreides rief menschliche Kultur hervor.

n der Nähe der Seehäfen, wo fremde Waren ausgeladen werden, tauchen jedes Jahr eine große Anzahl von fremden Pflanzen auf, deren Samenkörner durch Menschenhand hierher verschleppt wurden. Zwar die meisten dieser Pflanzen fühlen sich unserem Klima zu fremd, als daß sie wirklich bei uns festen Fuß fassen und sich einbürgern würden.
Eine geringe Menge von diesen Fremdlingen findet indes hier die Existenzbedingungen, die die Heimat ihnen bietet. Sie wachsen bei uns wild und sind von den einheimischen gar nicht mehr zu unterscheiden. Denn die Einwanderung ist seit den ältesten Zeiten erfolgt und die Pflanzen wurden nicht nur durch den Seeverkehr zufällig eingeschleppt, sie wanderten ebenso mit dem Getreide von Ort zu Ort, von den verschiedensten Seiten wurden sie über die Grenze gebracht, um bei uns Wurzel zu fassen und hier in der einheimischen Pflanzenwelt einen dauernden Platz zu erlangen.
Wahrscheinlich sind schon in den ältesten Zeiten fremde Pflanzen durch Menschen nach Deutschland verschleppt worden. Jedenfalls können wir in gewissen Ackerunkräutern solche alten, durch den Menschen zufällig eingeführten Fremdlinge erkennen. Die Kornrade, der Klatschmohn, die Kornblume, wohl auch der Feldrittersporn sind solche Eindringlinge, die sich an die Spur des Landmannes geheftet und mit ihm schon in vorgeschichtlicher Zeit ganz Deutschland erobert haben.
Als später von Rom aus sich die christliche Kultur nordwärts über die Alpen verbreitete, da zog neben den Kulturpflanzen unversehens auch manches bescheidene Kräutlein aus dem Süden bei uns ein &mdash aus dem Süden oder Südosten, denn nach Italien waren die Kulturpflanzen mit ihren Begleitgewächsen aus dem westlichen Asien gekommen.
Es läßt sich freilich im einzelnen nicht mehr nachweisen, welche Pflanzen sich damals in Deutschland akklimatisierten.
Doch haben sich damals verschiedene Gewürz- und Arzneikräuter bei uns angesiedelt, und zwar sind sie zu Unkräutern geworden, die in Gärten oder in und bei Dörfern einen ständigen Unterkunftsort gefunden haben. Allerdings werden sie auch vielfach noch vom Menschen kultiviert, aber neben den kultivierten Individuen gibt es immer eine Menge verwilderter, die ohne Zutun des Menschen alle Jahre wieder erscheinen und sich reichlich vermehren.
Georg Gentner führt als solche bei uns verwilderte Pflanzen aus dem Süden und Südosten an die Weinraute, die Ringelblume, das Mutterkraut, den Schlafmohn, die Salbei, den Wermut, den Andorn, den Ysop, den Boretsch und das Bohnenkraut.
Das sind alles Pflanzen, die in Bauerngärten sehr häufig anzutreffen sind und die hier meist keine besondere Pflege erfahren. Der Samen fliegt umher und dringt auch durch den Zaun des Gartens. An den Gartenzäunen besonders siedeln sich solche verwildernden Pflanzen an. Im Garten werden sie nur an besonderen Stellen geduldet, aber am Zaun verlieren die Hacke und der Spaten des Menschen ihre Macht. Der Boden ist aber hier noch locker genug, um den Pflanzen, die vorwiegend auf aufgelockertem Lande wachsen, die Existenz zu ermöglichen.
Auf demselben Wege haben sich wohl auch die Kugeldistel und das Zimbelkraut bei uns verbreitet, die oft in alten Burgen zu finden sind.
Auch das bekannte Löwenmaul, das in Gärten als Zierpflanze gezogen wird, tritt hier und da als Unkraut auf Schuttplätzen, an alten Mauern und selbst im Walde auf.
In viel späterer Zeit haben sich einige Pflanzen bei uns eingebürgert, die aus dem Südosten stammen, aber nicht von Italien aus, sondern von Rußland über Galizien her zu uns gebracht worden sind.
Das ist besonders mit dem Stechapfel der Fall, einer sehr interessanten Pflanze mit großen weißen Trichterblüten und seltsam geformten stacheligen Früchten. Diese Pflanze ist sehr giftig, und sie wird noch jetzt in der Arzneikunde verwendet. Man sagt, daß der Stechapfel durch die Zigeuner verbreitet worden sei. Er tritt sehr häufig auf Schuttplätzen und in verwilderten Gärten auf.

Abb. 13. Stechapfel.
Auch die Judenkirsche, ein kleines Kraut mit roten Beeren, die in einem weiten mennigroten Kelche stecken, ist wahrscheinlich durch Zigeuner oder durch Juden aus Asien eingeschleppt und von Ort zu Ort verbreitet worden.
Eine sehr große Menge von eingebürgerten Pflanzen verdanken wir Amerika.
Seit der Entdeckung dieses Erdteils, der uns an erstrangigen Kulturpflanzen den Mais, den Tabak, die Kartoffel und außerdem unzählige Zierpflanzen, Bäume, Sträucher und Blumen geliefert hat, sind nach und nach auch eine Menge Gewächse über den Atlantischen Ozean zu uns verschleppt worden, die sich bei uns vollständig akklimatisierten. In Nordamerika speziell haben ja viele Staaten genau dieselben klimatischen Verhältnisse wie bei uns. Die Pflanzen, die dort wachsen, besitzen aber zum Teil eine viel höhere Spannkraft als die unseren, da sie in ihrer Heimat mit einer viel reicheren Flora den Boden teilen müssen. Bei uns zeigten sie sich daher sehr überlegen, und sie okkupierten zum Teil mit großer Schnelligkeit ein weites Terrain.
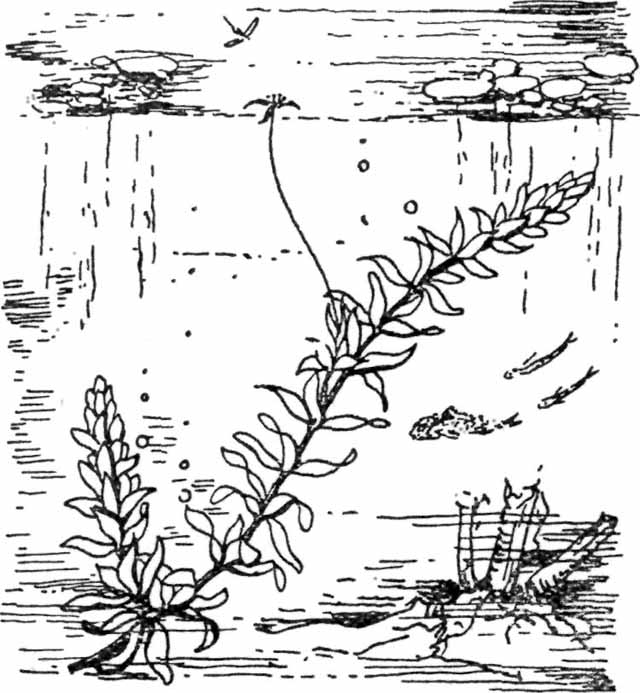
Abb. 14. Wasserpest.
Am bekanntesten ist von diesen amerikanischen Eindringlingen die berüchtigte Wasserpest geworden.
Ihre Geschichte läßt sich besser als die irgendeiner anderen eingeschleppten Pflanze verfolgen, da die Pflanze bekanntlich in solchen Mengen auftrat, daß sie hin und wieder ganze Seen und Flußläufe mit ihrem langen, sich endlos verzweigenden Stengeldickicht ausfüllte und dadurch den Fischfang und die Schiffahrt empfindlich störte. Nachdem die Wasserpest sich bereits im Jahre 1854 in England lästig gemacht hatte, wurde sie 1859 durch den Lehrer Boß in Potsdam in die Gärten von Sanssouci und 1860 durch den Kantor Buchholz beim alten Wasserfall bei Eberswalde ausgesetzt. Von hier aus drang sie durch ganz Norddeutschland und das übrige Deutschland vor. Der bekannte Pflanzengeograph P. Graebner berichtet, daß ihm mehrere Fälle bekannt sind, wo die Einnahmen der Ortschaften aus der Fischereiverpachtung infolge der Anwesenheit der Wasserpest nur noch einen Bruchteil der früheren betragen. An vielen Orten ist indes die Kraft der Pflanze bereits gebrochen. Der erwähnte Forscher meint, daß jede solche plötzlich mit großer Schnelligkeit vordringende Pflanze ihre bestimmte Zeit habe, nach der sie wieder seltener werde.
Sehr verbreitet sind auch zwei andere aus Nordamerika eingeschleppte Pflanzen, die zweijährige Nachtkerze und das kanadische Berufungskraut.
Die Nachtkerze, deren große gelbe Blüten sich des Abends öffnen, um nach zwei Tagen wieder zu vergehen, stammt aus Virginien. Sie ist seit 1614 in Europa bemerkt worden. An Flußufern, Eisenbahndämmen, auf Sandfeldern wachsend, ist sie namentlich im sandigen nordöstlichen Deutschland und in der Nähe von Dörfern ein lästiges Unkraut. An denselben Orten, fähig die größte Dürre auszuhalten, findet sich auch das kanadische Berufungskraut, ein hohes, aber unscheinbares Kraut mit kleinen weißlichen Kopfblüten.
Aus Amerika verschleppt ist wahrscheinlich auch der Feinstrahl, eine Pflanze, die unserer Gänseblume besonders in der Blüte ähnlich ist. Er wächst auf Grasplätzen, an Hecken und an Waldrändern.
Etwas weniger häufig als Nachtkerze und Berufungskraut ist die Gauklerblume, eine schöne Pflanze mit hochgelben, am Grunde rot gefärbten Blüten, die aus dem westlichen Amerika zu uns verschlagen worden ist. Sie wächst an Bächen und Flußufern und bevorzugt das gebirgige Land.
Denselben Standort liebt die schlitzblättrige Rudbeekia, die aus Nordamerika zu uns gekommen ist. Diese schöne, große, im Gesamtaussehen der Sonnenblume ahnliche, aber zierlichere Pflanze wurde im Jahre 1787 zum erstenmal in Schlesien wildwachsend gefunden.
In jüngster Zeit hält ein neues, aus Amerika eingeschlepptes Unkraut, das Knopfkraut, seinen Siegeseinzug in ganz Deutschland. Ein Kopfblütler mit unscheinbaren braungelben Blütenkörben, verbreitet es sich außerordentlich schnell nach der Art anderer Kompositen, der Kuhblume, der Distel, der Klette usw. Es nistet sich in Gärten ein und nimmt da sehr schnell überhand. Befähigt, selbst im Schatten unter Kohl und anderen Gemüsepflanzen zu leben, ist es sehr schwer auszurotten. Schnell im Wachstum und noch im Spätsommer schnell keimend und fruchtend, macht diese Pflanzenart sehr leicht die Energie des Menschen zuschanden. Sie ist jetzt schon fast überall in die Ortschaften eingedrungen, und wo sie noch fehlt, da kann man darauf gefaßt sein, daß sie demnächst erscheinen wird.
In rascher Ausbreitung begriffen ist auch die kleinblütige Balsamine, die jedoch nicht aus Amerika stammt, sondern im Osten in der Mongolei, in Zentralasien, ihre Heimat hat. Sie wurde im Jahre 1831 im Botanischen Garten zu Genf zum erstenmal angepflanzt. Im Jahre 1851 wurde sie wildwachsend in der Umgegend von Dresden angetroffen. Seit dieser Zeit hat sie sich dort unkrautartig vermehrt, aber auch an vielen anderen Orten Deutschlands, namentlich in Parkanlagen, macht sie sich gegenwärtig lästig.
Vom Osten her ist auch das Frühlingskreuzkraut nach Deutschland vorgedrungen. Es sieht dem gemeinen Kreuzkraut, einer der häufigsten Unkrautpflanzen unserer Gärten, im allgemeinen ähnlich, ist aber weit stattlicher, hat vor allem weit größere leuchtendgelbe Blüten und wollige Blätter. Es ist eine Sandpflanze, die neben der Zypressenwolfsmilch im Frühjahr die einzige Vegetation weiter Sandfelder des nordöstlichen Deutschlands bildet. Sie wurde im Jahre 1822 zum erstenmal in Schlesien bemerkt. Heute hat sie nach den Angaben Georg Gentners schon Schlesien, Posen, West- und Ostpreußen, Brandenburg, Pommern. Wollin und Rügen eingenommen und dringt im Norden in Mecklenburg, im Süden in der Provinz Sachsen, im Westen in Hannover weiter vor.
Neben diesen Fremdlingen, die sich weiter Gebiete Deutschlands bemächtigt haben, gibt es noch eine große Anzahl anderer, die nur eine ganz lokale Verbreitung in Deutschland haben. Die letzteren halten indes an ihrem kleinen Verbreitungsgebiete zäh fest, und so reihen sie sich in den Kreis unserer Flora ein, sie sind Bürger deutschen Bodens geworden.
VII. AUSSTERBENDE DEUTSCHE TIERE

ie Tierwelt der Erde hat von jeher ein außerordentlich wechselndes Aussehen gehabt.
Arten, Geschlechter, ja ganze Familien und Ordnungen schwanden, nachdem ihre Zeit abgelaufen, dahin, um neuen Formen Platz zu machen. Aus den Epochen der Erde, die der sogenannten Tertiärzeit voraufgingen, gibt es keine einzige sicher nachweisbare Tierart, die ihren Lebensfaden bis in die Gegenwart fortzuspinnen vermocht hätte.
Und auch später im Tertiär selbst tritt uns diese Wandlung der Formen entgegen, ja noch im Ausgang der Eiszeit starben mächtige Riesentiere, wie das Mammut, das wollhaarige Nashorn neben anderen weniger ansehnlichen Formen aus. Und in historischer Zeit sehen wir unter anderen den Ur, den mutmaßlichen Stammvater unseres Hausrindes, den Dronte, einen großen taubenähnlichen, gänzlich flugunfähigen Vogel der Insel Mauritius, den seltsamen nordischen Riesenalk und die ganze Familie der Dinornithiden und Aepyornithiden, gewaltiger straußartiger Riesenvögel Neuseelands und Madagaskars, vom Erdboden verschwinden.
Der Vorgang des Aussterbens gehört eben überhaupt nicht nur der Vergangenheit an. Auch in der Gegenwart können wir beobachten, wie manche Tiere seltener und seltener werden, wie sie in verschiedenen Ländern ganz und gar verschwinden und schließlich auf ein recht kleines Verbreitungsgebiet beschränkt sind. Wo immer wir diese Erscheinungen wahrnehmen, da sind sie das Zeichen dafür, daß das betreffende Tier seine Lebenstüchtigkeit verloren hat und sein Untergang in absehbarer Zeit gewiß ist.
Es ist eine nicht unbedeutende Anzahl auch von deutschen Tieren, denen heute so das Schicksal des Aussterbens droht. Ja es ist kein Zweifel, daß die Vernichtung verschiedener Lebewesen in der Gegenwart schneller und in größerem Umfange stattfindet, als dies jemals vordem der Fall gewesen ist. Wir wissen allerdings nicht, was die Ursachen waren, warum die gesamte Tierwelt der vortertiären Zeit ohne Ausnahme zugrunde gegangen scheint, aber ohne Zweifel sind es große erdumgestaltende Faktoren gewesen, Veränderung des Klimas, der Festländer und Meere und ähnliches, Faktoren, die zwar allmählich wirken mochten, aber nach vielen Tausenden oder Hunderttausenden von Jahren eine vollständige Umwandlung der vorhandenen Kräfte hervorbrachten.
Derartige Ursachen scheinen nun gegenwärtig ausgeschlossen, denn die erdphysikalischen Kräfte, besonders das Klima, haben seit den wenigen Jahrhunderten, seitdem das Aussterben gewisser heutiger Tiere beobachtet wird, wohl kaum eine ernstliche Veränderung erlitten.
An die Stelle dieser Naturkräfte aber ist nun eine Macht getreten, die für viele Lebewesen vielleicht ebenso schädlich oder gar bei weitem verderbenbringender ist: die menschliche Kultur.
Die Beobachtungen über aussterbende Tiere beziehen sich allerdings gewöhnlich nur auf die größeren und höher entwickelten Arten.
Ueber den mutmaßlichen Untergang von Insekten, Würmern, Krustentieren und anderen gibt es meist keine authentischen Nachrichten, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß diese Erscheinung bei allen Tieren vorhanden ist. Ob aber bei jenen unkontrollierbaren Tieren der Mensch auch immer die Ursache der Ausrottung ist, läßt sieh natürlich nicht entscheiden. Denn wer kann sagen, ob nicht z. B. ein Schmetterling der äquatorialen Gegend jetzt dem Untergang entgegenginge, weil die dortige Durchschnittstemperatur um einen, wenn auch wenig merkbaren Gradbruchteil herabgesunken wäre?
Jedenfalls aber ist bei allen den Tieren, deren Aussterben genau kontrolliert werden konnte und vor allem unseren deutschen, der schädliche Einfluß der menschlichen Kultur direkt nachzuweisen.
Am allermeisten sind heute zwei riesige, einander merkwürdigerweise sehr nahestehende Tierarten unserer Erde in ihrer Existenz bedroht: der ehemals auch zu unserem deutschen Jagdwild gehörige Wisent (Bison europaeus) und sein einziger unmittelbarer lebender Verwandter, der nordamerikanische Bison (Bison americanus). Und nirgends läßt sich besser feststellen als hier, daß der Mensch das Schicksal dieser Tiere bestimmt hat.
Der Wisent, dieses zu den Wildrindern gehörige größte Tier Europas, lebte früher allgemein in den undurchdringlichen Wäldern der Mitte unseres Erdteils, als sie noch keine Kultur, nicht einmal der Ackerbau, gelichtet hatte. Für die Römer war er ein Charaktertier Germaniens, also des damaligen Deutschlands. Zur Zeit Karls des Großen und bis tief ins Mittelalter war er nachweislich noch zahlreich bei uns erhalten, begann indessen allmählich mit dem deutschen Urwalde abzunehmen. Aber erst im achtzehnten Jahrhundert, nachdem die Kultur inzwischen von Westen her bis in die Ostspitze Deutschlands vorgedrungen war, wurde der letzte Wisent im Jahre 1755 in Ostpreußen, und damit der letzte seines Geschlechts auf unserer engeren Heimaterde überhaupt, erlegt. Etwa um die gleiche Zeit schwanden seine letzten größeren europäischen Bestände in Siebenbürgen. Bis auf unsere Tage fortgelebt hat dann bekanntlich ein kleines Häuflein der wunderbaren Geschöpfe noch in dem abgeschlossenen Walde von Bialowicza (Bialowies) in Litauen, als gehegtes Jagdwild des Zaren seit 1802 durch ein besonderes Gesetz geschützt. Das war ihre allerletzte europäische Station. Weniger bekannt pflegte zu sein, daß das Tier in einem vielleicht tausend Köpfe zählenden Trupp sich außerdem noch im asiatischen Kaukasus und zwar dort in ursprünglicher Freiheit behauptet hatte. In Bialowicza betrug der Bestand um 1914 noch an siebenhundert Stück. Trotz aller Pflege waren schon damals die Aussichten auf dauernde Erhaltung aber nicht mehr sehr günstig. Abgesehen von den geringfügigeren Verlusten durch Abschießen einzelner Tiere bei den Zarenjagden, Fall durch Bären und Wolfe, die lange noch daneben lebten, oder Versand an zoologische Gärten, drohte am verderblichsten die stete Inzucht zu werden. Immerhin hätte rechtzeitige Blutauffrischung durch kaukasische, ein klein wenig in der Rasse abweichende Exemplare den Untergang nach dieser Seite vielleicht noch aufhalten können. Den Garaus aber machte in unhemmbarer Katastrophe der Weltkrieg. Schon bei den ersten Kämpfen und Truppendurchmärschen im Walde fielen mehrere hundert Stück. Eine Weile suchte die deutsche Forstverwaltung noch in sehr umsichtiger Weise zu retten. Als auch sie 1918 aber den Ort verlassen mußte, haben die eindringenden Bauern den gesamten Bestand bis auf den letzten Kopf niedergeschossen, um aus den Häuten Stiefel zu machen. Da eine fast ebenso radikale Vernichtung um die gleiche Zeit über den Kaukasusrest erging, sind gegenwärtig fast nur noch die etwa fünfzig Stück, die sich im Wildpark von Pleß (aus Bialowicza seit 1865 bezogen), bei Hagenbeck und in den verschiedenen zoologischen Gärten zufällig erhalten, von dem ganzen Geschlecht der imposanten Tiere übrig. Eine großzügige Rettungs- und Weiterzüchtungsaktion, zu der sich eine ganze Gesellschaft von Tierforschern und Forstkundigen kürzlich zusammengetan, hofft immer noch, auch mit diesem winzigen letzten Bestande die Art einstweilen zu sichern, und man wird ihr den möglichsten Erfolg wünschen müssen, sich aber zugleich nicht verhehlen dürfen, daß die Aussichten schwach sind.
Hat in diesem Falle immerhin das Verhängnis einer Kriegskatastrophe das Schicksal beschleunigt, so wäre der amerikanische Bison um ein Haar bereits ein Opfer rohester Massenschlächterei in völliger Friedenszeit geworden. In noch nicht fünfzig Jahren hatten die nordamerikanischen Büffeljager die bis gegen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts erhaltenen Millionenbestände dieser Bisons bis ebenfalls auf ein paar hundert Stück reduziert, dem eigenen Lande eine bei rationeller Hege ganz ungeheure Einnahmequelle auf einen Schlag dadurch vernichtend. Damals hat allerdings die amerikanische Regierung noch in letzter Stunde mit wirklichem Glück, scheint es, eingegriffen, indem sie ein drakonisches Gesetz erließ, Schutzparke mit Winterfütterung einrichtete und die letzten Bestände aufs genaueste unter „Polizeiaufsicht” nahm. Es heißt, daß damit die Art dort einstweilen gerettet sei, wenn auch nur als Jammerrest gegenüber ehemaliger Herrlichkeit und in kleinstem Winkel des früheren ungeheueren Verbreitungsgebiets, unter Verzicht auch dort auf ein eigentliches freies Wildleben der alten Kolosse.
Das Schicksal des Aussterbens steht auch dem Alpensteinbock unmittelbar bevor. Es fragt sich allerdings, ob man die Steinböcke, die in Sibirien, im Kaukasus und einigen anderen Gebirgen leben, als verschiedene Arten anzusehen hat. Sie weichen von einander nur sehr wenig ab, trotzdem werden sie in der Regel als gesonderte Spezies betrachtet. Der Alpensteinbock jedenfalls ist aber dem Untergange bereits so nahe, daß auch er nur noch in kaum zweitausend Exemplaren vertreten ist. Einst war er in den Alpen der Schweiz ein häufig anzutreffendes Wild, das sogar noch bis in die Voralpen kam. Das schöne, stattliche Tier reizte die Jagdlust natürlich ungemein, die verbesserten Schußwaffen halfen es sehr bald allenthalben ausrotten. Heute ist der Steinbock nur noch in den Gebirgszügen von Piemont vorhanden, und hier ist die Jagd auf ihn fast ganz untersagt und weitgehender Schutz durchgeführt. Es verhält sich also mit diesem Tiere ähnlich wie ehemals mit dem Wisent im Walde von Bialowicza: er lebt von der Gnade des Menschen, ohne dessen Fürsorge und Schonung er bereits seit Jahrzehnten ausgestorben wäre.

Abb. 15. Alpensteinbock.
Entsprechend gibt es noch eine Menge von Tieren, deren vollkommenes Aussterben zwar noch in weiter Ferne liegt, die aber in Deutschland selbst entweder bereits ausgerottet oder in ihrer Existenz bedroht sind. Solche Tiere zeigen zum mindesten, daß sie sieh einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe des Menschen nicht anzupassen vermögen, und da die Kultur nun einmal in steigenden und stetig breiter werdenden Bahnen verläuft, so ist anzunehmen, daß diese Lebewesen von ihr immer weiter zurückgedrängt und schließlich auch ganz aus dem Wege geräumt werden. In dieser Lage befinden sich vor allem der Bär, der Wolf und der Luchs. Alle drei sind, wenn auch erst im abgelaufenen Jahrhundert, im engeren Deutschland als Standtiere ausgerottet worden.
Der Luchs, zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in Bayern noch allen Jägern vertraut, wechselt jetzt nur ganz vereinzelt noch einmal von Polen nach Ostpreußen herüber. Der Wolf, noch im Jahre 1817 innerhalb der Grenzen Preußens in tausendachtzig Stück abgeschossen, ist entsprechend zu einem Zeitungsereignis geworden, wenn er in unserem Osten oder Südwesten als solcher Irrgast auftaucht. Gänzlich unbekannt geworden ist in Deutschland wie in Belgien, Holland, England und der Schweiz der wilde Bär. Trotzdem sind alle drei als Art zäh genug, sie halten sich noch in an Deutschland grenzenden Gebieten, der braune Bär vor allem auch auf den großen europäischen Gebirgen wie den Karpathen, den Transsylvanischen Alpen und den Höhen Skandinaviens, und wenn sie auch hier vielleicht in einiger Zeit verschwinden werden, so bieten ihnen Rußland und Sibirien wahrscheinlich noch für lange ein sicheres Unterkommen.

Abb. 16. Luchs.
Fast ebenso liegen die Verhältnisse für das Elen oder den europäischen Elch (Alces alces), den gewaltigen Hirsch, der einst ebenfalls über ganz Nord- und Mitteleuropa verbreitet war. Bei ihm ist der stufenweise Rückzug vor der Kultur noch deutlicher wahrnehmbar. Mit dem Vordringen der Römer nach Gallien wird der Elch hier seltener. In demselben Grade wie dann die Kultur ostwärts vordringt, weicht auch er zurück. C. Grewe hat diese Verdrängung des Elentiers in einem Artikel in der Zeitschrift „Zoologischer Garten” dargestellt. In Westdeutschland wurde der Elch bereits im zehnten Jahrhundert selten, im zwölften starb er aus. Vom sechzehnten Jahrhundert an nehmen die Tiere in ganz Deutschland, abgesehen vom äußersten Osten, bedeutend ab. Im vorvorigen Jahrhundert werden sie überall ausgerottet, mit Ausnahme von Ostpreußen. Hier werden sie nun im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts ebenfalls immer seltener. Jetzt werden sie nur in einigen Forsten, besonders dem von Ibenhorst, noch gehegt. Einmal war die Zahl der stattlichen Tiere auch so bereits auf elf herabgesunken, später ist aber ihre Zahl wieder einigermaßen gewachsen, so daß der Bestand in Ostpreußen sich jetzt auf vielleicht vierhundertfünfzig Köpfe beläuft. So wenig auch dieses Tier einer geregelten Forstwirtschaft standzuhalten vermag, so hat es doch in den Wäldern Rußlands, Sibiriens und in engverwandter Art auch Nordamerikas noch auf lange Zeit hinaus wohl einen gesicherten Wohnplatz.
Noch in völliger „Wildheit”, aber ebenfalls jammervoll reduziert, lebt in Deutschland der Biber, doch er ist so selten geworden und überhaupt nur noch in wenigen Exemplaren (im Jahre 1913 nicht ganz hundert) an der Elbe bei Dessau vorhanden, daß auch zu seiner Erhaltung in unserem Vaterlande bereits schärfste Mahnungen von Sachkundigen ergehen. In Frankreich haust er noch an der Rhone, dagegen ist er etwas häufiger in Rußland und Sibirien zu treffen, wenn auch überall im Absterben begriffen.
Unter den Vögeln ist der gewaltige Lämmergeier, der größte Raubvogel der alten Welt, der früher noch in den Bayrischen Alpen vorkam, jetzt in Deutschland wie der Schweiz endgültig ausgerottet, während er in den Mittelmeerländern, seiner eigentlichen Heimat, noch dauert. Die erwähnten Tiere sind solche, deren Verbreitungsgeschichte schon seit langem verfolgt wird und darum auf sicherer Beobachtung beruht. Daß aber noch einer Menge anderer, besonders unansehnlicher und darum weniger kontrollierbarer deutscher Tiere der Untergang zu weissagen ist, unterliegt keinem Zweifel.
Das preußische Schutzgesetz von 1920 bezeichnet bereits nicht weniger als zweiundzwanzig Vogelarten und Säugetiere, die unbedingt und das ganze Jahr zu schützen seien, nicht nur, weil sie eine Zierde unserer Landschaft darstellen, sondern durchweg auch, weil bereits Gefahr der Ausrottung besteht. Bei den Vögeln finden sich u. a. dort Uhu, Kormoran, Rohrdommel und andere Reiher, Höckerschwan, der bereits hochgradig bedrohte schwarze Storch und der aussterbende Kolkrabe, unter den Säugern neben dem Biber der Siebenschläfer nebst Verwandten und der äußerst seltene Nerz oder Sumpfotter.
Auch von einem charakteristischen deutschen Schmetterling, dem wundervollen Apollofalter (Parnassius apollo), ist neuerlich festgestellt worden, daß er wenigstens in einem besonders interessanten Teile seines Gebietes, dem schlesischen Gebirge, in den letzten fünfzig Jahren radikal ausgerottet worden ist, und zwar wesentlich durch Schuld gewissenloser Insektenhändler, die ihn rücksichtslos abfingen.
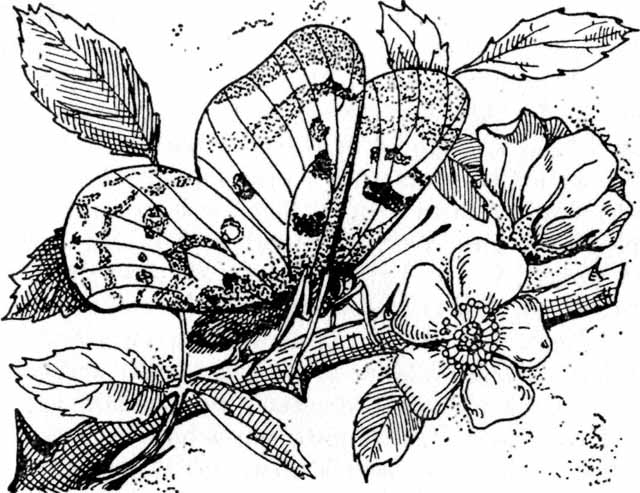
Abb. 17. Apollofalter.
Die unvernünftige, unrationelle Ausrodung der Wälder, aber auch die intensivere und auf größeres Terrain ausgedehnte Bodenbewirtschaftung tragen neben solchen Einzelausbeutungen die Hauptschuld, daß auch Tiere vernichtet werden, die uns in vieler Beziehung nützlich oder durch ihre Belebung der Landschaft angenehm sind. Die Kultur hat besonders in Deutschland die großen und schädlichen Raubtiere ausgerottet. Leider wird sie nun eine Menge unschuldiger oder gar nützlicher Wesen verdrängen, wenn nicht beizeiten für deren weiteres Fortbestehen allgemein Sorge getragen wird. Die Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse ist ja jetzt entschieden gewachsen und mit ihr die Anteilnahme an unserer heimischen Tierwelt. Vielleicht trägt dieses Interesse dazu bei, besonders unseren hilfsbedürftigen Vögeln überall Schonung oder gar Pflege angedeihen zu lassen. So wenig bei der Vernichtung schädlicher Tiere Sentimentalität angebracht wäre, so sehr muß es doch jedermanns Streben sein, unser einheimisches Naturleben möglichst vor Verarmung zu schützen.
VIII. VERÄNDERUNGEN IN DER DEUTSCHEN VOGELWELT

n unwandelbarem Kreislauf scheint die Natur jahraus, jahrein ihre Bahnen abzuschreiten.
Zur Zeit der Schneeschmelze bricht das Schneeglöckchen hervor, der Star und die Lerche kommen an. Nach einigen Wochen milder Tage blühen die Erlen und dann rückt der Mai mit seiner Frühlingspracht heran. Und so vollzieht sich alles in der gleichen Weise, wie es unsere Vorfahren vor Hunderten und Tausenden von Jahren beobachtet haben.
Wenn man freilich schärfer ins einzelne sieht, so wird man doch manche nicht unbedeutenden Veränderungen in der Natur unserer Heimat schon seit verhältnismäßig kurzer Zeit konstatieren können.
Gerade in dem vergangenen Jahrhundert hat sich die Herrschaft des Menschen über die Natur in schneller und umfassender Weise vergrößert, und die Folge davon sind erhebliche Umwälzungen in der Pflanzen- und Tierwelt gewesen. Die Pflanzenwelt ist am meisten und am sichtbarlichsten von der wachsenden Macht der Kulturmenschheit beeinflußt worden. Demnächst folgen die Säugetiere, während die Vögel diesen Einfluß meist noch in etwas geringerem Maße erfahren haben.
Nun muß man aber unterscheiden zwischen dem - ich möchte sagen quantitativen und dem qualitativen Einfluß des Menschengeschlechts auf die Natur.
Der erste ist der stärkste, er besteht darin, daß der Mensch den Raum, den ein Lebewesen früher innehatte, erweiterte oder verengerte. Durch Anbau einiger Kulturpflanzen und Haltung von einigen Haustieren verschob er das quantitative Verhältnis der Lebewesen in eingreifendster Weise. Aber auch der qualitative Einfluß macht sich in den Veränderungen von Lebensgewohnheiten, in der Einwanderung ausländischer und dem Aussterben einheimischer Arten bemerkbar.
Was die Vögel anbelangt, so haben natürlich auch sie zunächst diesen quantitativen Einfluß am stärksten erfahren. Die Verringerung des Waldes, die Ausdehnung der Ackerlandschaften haben das Terrain der Waldvogel verkleinert, während dieselben Umstände die Zahl der Erdbrüter und der körnerfressenden Arten vermehrt haben. Besonders mußten auch die Vögel ihr Gebiet vergrößern, die sich direkt an die Sohlen des Menschen heften, wie die Sperlinge, die Schwalben und die Stare. Mit der Zunahme der Bevölkerung, mit der Vergrößerung ihrer Ansiedlungen mußte auch ihre Zahl in entsprechendem Verhältnis zunehmen.
Wenn auch diese Veränderung in der Vogelwelt, bei der es sich um gewaltige Zahlen und Räume handelt, von schwerwiegendster Bedeutung ist, so hat sie doch an und für sich auf die Gewohnheiten der Vögel und die geographische Verbreitung der Arten keinen Einfluß ausgeübt. Der Wald, die Wiese, das Feld, jede Landschaft, jede deutsche Provinz beherbergt dieselben Vögel wie vorher, wenn auch in geringerer oder größerer Anzahl. Von besonderem Interesse sind nun aber die Wandlungen, die nicht mit diesen rein quantitativen Verhältnissen zusammenhängen.
Es ist sehr merkwürdig, wie manche Vögel direkt gewissen Aeußerungen der modernen Kultur folgen.
Fast in demselben Maße wie der Bau der Fahrstraßen in den letzten hundert Jahren in Deutschland zugenommen hat, haben sich auch die Haubenlerchen bei uns verbreitet. Es handelt sich hier nicht etwa um eine bloße Vermehrung einer bereits früher in Deutschland heimischen Art. Vor einem Jahrhundert war die Haubenlerche in den meisten Ländern des Reiches noch ein unbekannter Vogel. Sie hat also ihr geographisches Verbreitungsgebiet nach und nach vergrößert, so daß sie nun fast in ganz Deutschland, mit Ausnahme einiger südwestlicher Distrikte, zu Hause ist.
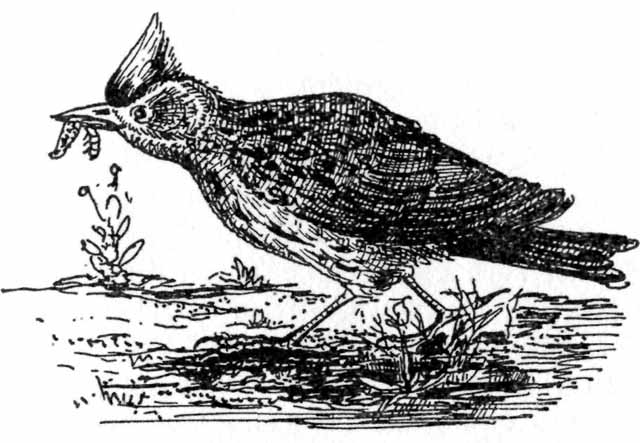
Abb. 18. Haubenlerche.
Ursprünglich stammen die Haubenlerchen aus den Steppen Innerasiens und haben sich von hier nach und nach, dem Zuge nach dem Westen folgend, über Vorderasien und Südeuropa verbreitet. Aber erst im letzten Jahrhundert haben sie, von Osten aus Rußland und Polen kommend, unser Vaterland überzogen. Die Haubenlerchen sind recht eigentliche Bewohner der Landstraße, der Chaussee. Diese glatten, geebneten vegetationslosen Wege mögen ihnen das Bild der Steppen und Wüsten Asiens vormalen, wo einst ihre Heimat war. Gewohnt, mit ihren Füßchen schnell über die Erde zu trippeln, ohne zu fliegen, haben sie in den harten, ebenen Straßen den besten Fußboden. Und auch an Nahrung mangelt es ihnen hier nicht. Von den Fuhrwerken fällt mancherlei ab, vor allem pflegen die Haubenlerchen die Abgänge der Pferde nach unverdauten Körnern, vielleicht auch nach Insekten, zu durchsuchen. Darin haben sie kaum einen Konkurrenten auf der Fahrstraße, solange das Pferd selbst nicht vom Auto verdrängt ist, was ja allerdings bevorsteht. Denn die Spatzen hängen an dem Weichbilde der Ortschaften, Finken, Grünlinge, Goldammern sitzen mehr auf den Bäumen der Straße, um links und rechts in die Felder einzufallen. Den Fahrstraßen folgend, sind die Haubenlerchen immer weiter westwärts gewandert und so auch in unser Vaterland vorgedrungen. Je spärlicher das Wegenetz war, um so langsamer ging der Vormarsch.
Erst als im vergangenen Jahrhundert die Ortschaften systematisch durch gepflasterte Wege verbunden wurden und der Verkehr wuchs, dehnte sich das Verbreitungsgebiet dieser Vogel rascher aus. Jetzt sind sie, auf dem Wege von der Oder her, in Norddeutschland heimisch geworden, nachdem sie anfänglich an der See hingewandert waren und um 1820 in Oldenburg, um 1840 in der Priegnitz und 1857 in Westfalen aufgetreten oder häufiger geworden waren. In Süd- und Mitteldeutschland ging die Wanderung langsamer vor sich, und noch jetzt fehlt die Haubenlerche in einigen Gegenden.
Die Haubenlerche ist geeignet, sich alle Kulturländer zu erobern. In England, wohin sie bisher nur ausnahmsweise einmal verschlagen worden ist, wird sie wahrscheinlich auch noch festen Fuß fassen. Außer ihrer großen Befähigung, auf den Chausseen zu leben, hat sie auch die Neigung, zumal des Winters in die Dörfer zu kommen, um hier Sämereien aufzulesen. Dabei tritt sie bescheiden auf, sie dringt nicht in die Speicher ein, raubt nichts von Fruchtbäumen und Saatbeeten wie die Spatzen und Stare und erfreut sich daher der Gunst des Menschen. Man sieht den artig dahintrippelnden Vogel gern und ist erfreut über den munteren Ruf, den er selbst im härtesten Winter häufig genug hören läßt.
Noch ein anderer Vogel hat sein Verbreitungsgebiet, allerdings nur zum Teil mit Hilfe der Chausseen, erweitert. Es ist der Girlitz, ein Verwandter des Zeisigs, und kaum noch artlich scharf zu unterscheiden von der wilden Stammform unseres altbekannten Kanarienvogels, von grünlicher Färbung.
Dieser kleine, zierliche Vogel hat seine ursprüngliche Heimat in Kleinasien und Südeuropa, aber seit dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ist er auch in Deutschland eingedrungen. Zunächst folgte er wohl dem Rhein und gelangte im Jahre 1818 auf einem Abstecher in das Maingebiet nach Frankfurt, 1835 ist er in Hanau und erst 1883 in Würzburg angelangt. Von Südosten her drang er über Wien bis Bayern vor, 1870 erreichte er auf dem Einfallsweg der Elbe Schandau, auf der Linie der Oder kam er 1866 nach Breslau, Ende der siebziger Jahre traf er bei Frankfurt an der Oder und bei Berlin ein. Und nun dringt der Vogel immer weiter nordwärts und ostwärts vor. Jetzt ist er auch in Preußen angelangt und kommt in der Umgegend von Danzig häufig vor. Der bekannte Vogelforscher Fritz Braun schreibt die Verbreitung des Girlitzes hier der Durchbrechung der großen Waldlinie Neustadt in Westpreußen, Tuchel, Bromberg, Thorn zu, die früher, von sumpfigen Flußtälern durchschnitten, den Osten Deutschlands von dem übrigen Reiche trennte.

Abb. 19. Girlitz.
Der Girlitz liebt zwar Waldränder, aber er meidet doch den geschlossenen Waldbezirk, er will, da er von den Samen der Gräser und Kräuter lebt, offenes Land, Aecker und Wiesen in der Nähe haben. Die große Waldlinie stellte ihm zunächst ein Hindernis für seine weitere Verbreitung entgegen. Allein jetzt ist diese Waldlinie von einzelnen Kulturflächen, von fruchtbaren Feldern, gartenreichen Dörfern und Lauballeen durchbrochen, sie sind die Einwanderungsstraßen für den Girlitz in Westpreußen gewesen. Zum Teile waren es also wohl auch die Fahrstraßen, die der Girlitz zur Erweiterung seines Gebietes benutzte.
Immerhin ist es hier mehr die allgemeine Entwicklung der Kultur, die Lichtung der Wälder und die Entstehung gartenreicher Ortschaften gewesen, die ihm das Vordringen ermöglichten. Warum dieser Vogel freilich nicht schon früher in Deutschland eingewandert ist, bleibt trotzdem rätselhaft. Denn in Süd- und Mitteldeutschland hätte er schon seit vielen Jahrhunderten die Bedingungen zu seinem Fortkommen gefunden. Möglicherweise vermochte er indes die Gebirgs- und Waldketten nicht zu durchbrechen, die Mitteleuropa von Südeuropa trennen. War ihm hier erst einmal eine Durchzugsstraße eröffnet worden, so mußte sein Vordringen nach Deutschland verhältnismäßig rasch vonstatten gehen.
Einem modernen Zuge der Kulturentwicklung ist die Amsel gefolgt, sie ist eine Großstädterin geworden.
Die Amsel (Schwarzdrossel) mit ihrem glockenhellen Gesang war noch vor hundert Jahren nur als stiller, scheuer Bewohner des tiefen, an dichtem Unterholz reichen Waldes bekannt. Allmählich aber hat sie nicht nur ihren Aufenthaltsort, sondern auch ihr Benehmen geändert. Sie ist in die Gärten, in die Parkanlagen und die mit Ziergehölzen geschmückten Plätze der Großstädte übergesiedelt. In den letzteren ist sie seit einigen Jahren immer häufiger geworden, und es ist anzunehmen, daß sie auch in den Großstädten, in denen sie jetzt noch fehlt, über kurz oder lang ihren Aufenthalt nehmen wird. An diesen Stätten mag sie Feinden viel weniger ausgesetzt sein als im Walde. Nahrung findet sie hier mindestens ebensoviel, da sie den Vorrat an Insekten und kleinem Gewürm mit weniger Konkurrenten zu teilen braucht.
Die Amsel hat sich auch in ihrem Wesen vollständig geändert. Sie ist jetzt nicht mehr scheu, vor den Menschen hat sie keine Furcht, vielmehr kann man sie in den städtischen Parkanlagen jederzeit in nächster Nähe beobachten.
Die Amsel verzehrt gelegentlich auch Beeren, und vielleicht hat sie sich auch diese Neigung erst durch ihren Aufenthalt in Gärten und Parkanlagen erworben, in denen fruchttragende Bäume und Sträucher in Mengen vorhanden sind.
Neuerdings werden ihr arge Näschereien und Verwüstungen in Nutz- und kleinen Ziergärten nachgesagt, selbst als Neste-Plünderer gegenüber kleineren Singvögeln ist sie beobachtet worden. Allein diese Uebergriffe dürfen nicht überschätzt werden; die Amsel kann im allgemeinen nicht als schädlicher, sondern muß als nützlicher, insektenvertilgender Vogel angesehen werden.
Durch die Entstehung der modernen Großstädte ist keineswegs allen Vögeln, welche die Nähe des Menschen lieben, ein Vorteil entstanden.
Die Spatzen haben sich zwar auch in dieses steinerne Hausdickicht hineingefunden und sind auf allen Straßen und Plätzen in Mengen vorhanden. Aber es fragt sich doch, ob sie in dem Maße zugenommen haben, wie die Bevölkerung stärker geworden ist. In Anbetracht der Menschenzahl, die eine einzige Mietkaserne der Stadt beherbergt, ist der Belauf an Spatzen in der Großstadt nicht bedeutend. Hätte jede von diesen Familien, die heute in großen Häusern zusammen wohnen, ihr eigenes Wohnhaus wie früher, so würde die Zahl der Spatzen ohne Zweifel bedeutend größer sein.
Auch die Schwalben finden in den Großstädten nicht das rechte Unterkommen, einmal ist ihnen hier das Brüten sehr erschwert, da teils die Nester nicht geduldet werden, teils die Räume, die Nistgelegenheiten bieten würden, nicht genügend vorhanden oder doch nicht jederzeit so zugänglich sind, wie die Scheunen und Ställe auf dem Lande. Auch dürfte es ihnen wohl im Innern der Großstädte, wo Fliegen und Mücken wenig zahlreich sind, an Futter mangeln. Außerdem haben sie hier an dem Mauersegler einen starken Konkurrenten, der mit außerordentlicher Geschwindigkeit in unermüdlichem Fluge um die Türme und Häuser nach Insekten jagt.
Die Großstadt scheint auf die Vögel im allgemeinen ähnlich zu wirken wie auf den Menschen: sie vertreibt die Schüchternheit. Die Spatzen sind auf dem Lande nicht so zutraulich und dreist wie in der Stadt. Darüber braucht man sieh nicht zu wundern, denn hier können sie nur selten Schaden stiften oder der Schaden, den sie anrichten, trifft nur wenige Menschen. Im allgemeinen tut niemand in der Stadt einem Spatz etwas zuleide. Nach ihnen werfen, schießen, Fanggeräte aufstellen, ist an und für sich in der Großstadt meist unmöglich. Aber es fällt wohl auch selten einem ein, die Tiere fortzuscheuchen. Der Städter hat vielmehr seine Freude an dem Vogel, der ihm noch ein Stück freier Natur vorstellt. Die Spatzen haben übrigens, worauf der bereits genannte Fritz Braun in einer anderen Schilderung aufmerksam macht, in der Großstadt noch eine andere Gewohnheit angenommen. Sie schlafen hier nicht unter Dach und Fach, sondern bringen die Nacht auf Straßenbäumen zu, selbst im Winter.
Auch die Schwalben sind in der Stadt noch zutraulicher geworden, als sie es auf dem platten Lande sind. Sie legen ihr Nest im Innern von Fabriken an und lassen sieh durch das Getöse der Maschinen und das Ein- und Ausgehen der Arbeiter nicht stören. Nach den Beobachtungen des Franzosen Pouchet ist die Hausschwalbe im Begriff, ihre alte Nestkonstruktion zugunsten einer neueren, bequemeren Bauweise zu verändern. Die früheren Nester waren kugelförmig und hatten oben nur einen kleinen Eingang, der gerade so groß war, daß eine Schwalbe hindurchschlüpfen konnte. Jetzt legen die Schwalben meist ein Nest von ovaler Form an, das oben eine langgestreckte Eingangs-Öffnung besitzt. Dadurch sind die jungen Schwalben nicht mehr gezwungen, aufeinanderzuhocken, sie können ihre Köpfe herausstecken und die Alten können, ohne das Nest von Licht und Luft abzusperren, ein- und ausfliegen.
Sehr viele Vögel sind auf der anderen Seite natürlich auch in ihrem Besitzstand durch die intensiver werdende Kultur beeinträchtigt worden.
Bei einigen geht diese Beeinträchtigung so weit, daß sie nicht nur an Zahl ihrer Individuen verloren haben, sondern daß sich auch ihr geographisches Verbreitungsgebiet mehr und mehr verringert hat. Das ist besonders bei den Adlern der Fall, die immer mehr aus Deutschland verdrängt werden und sich nur noch in den von Kultureinflüssen wenig veränderten Gebieten, den Alpen und dem Osten und Nordosten Deutschlands, erhalten haben.

Abb. 20. Schwarzer Storch.
Auch der Schwarzstorch, der die Nähe des Menschen flieht, ist immer mehr auf die einsamen Waldungen des Ostens zurückgedrängt worden und geht augenblicklich gerade unter unseren Augen mit den letzten Horsten ein. Wozu als betrübliche Nebentatsache zu melden ist, daß auch unser alter Kinderfreund, der weiße Storch, sich verändert — er brütet nicht mehr so zahlreich, wobei allerdings diesmal eine „eigene” Ursache bei ihm mitsprechen muß, da ihn der Mensch nicht verfolgt.

Abb. 21. Weißer Storch.
Das gleiche Schicksal ist der Großtrappe beschieden, während die Zwergtrappe, die Südeuropa bewohnt, neuerdings an einigen Stellen Deutschlands wenigstens vorübergehend gebrütet hat.
Sehr merkwürdig ist es aber, daß ein Vogel anstatt von Süden nach Norden, umgekehrt von Norden her sein Verbreitungsgebiet über Deutschland verschiebt. Die Wacholderdrossel dringt von Norden her seit einem Jahrhundert in unser Vaterland ein. Ursprünglich in den Birkenwaldungen des Nordens heimisch, wurde sie am Ende des achtzehnten Jahrhunderts auch als Brutvogel von Ostpreußen erwähnt. Möglich, daß sie sich hier schon lange aufgehalten hat. Seit dieser Zeit aber beginnt ihre eigentliche Verbreitung nach dem Süden, die langsam vor sich gegangen ist. 1854 war die Wacholderdrossel bis in die Berliner Gegend gekommen, 1852 nach Thüringen, dann ist sie bis Mittelfranken vorgerückt. Was den Vogel veranlaßt hat, sein kaltes Wohngebiet zu verlassen und bis in das warme Mitteldeutschland vorzudringen, ist nicht zu erkennen. Der Vogel muß auch hier wohl sich selbst verändert haben. Er muß sich den neuen, bequemeren Verhältnissen angepaßt haben, ähnlich wie seine Verwandte, die Amsel, sich gewissermaßen modernisiert hat, ein neues Beispiel dafür, daß auch die Tiere in verhältnismäßig kurzer Zeit ihre Gewohnheiten verändern können.
IX. DIE KULTUR UNSERER GARTENBLUMEN

eit uralter Zeit sind Blumen gepflegt worden, und die Liebe zu ihnen ist von jeher so allgemein, daß es kaum eine Familie gibt, in der nicht der eine oder andere eine lebhafte Neigung zu den Blumen bekundete. Es ist ja vor allem die Schönheit und der köstliche Duft, um derentwillen man sie pflegt, aber es spricht sich doch in dieser Pflege auch eine Liebe zur Natur aus, die leider dem Städter immer ferner rückt und von der er sich auf seinem Fensterbrett oder Balkon oder auf seinem Blumentisch ein kleines Abbild hervorzuzaubern sucht.
Gerade in unserer Zeit, in der alles, was mit der Natur zusammenhängt, der Gegenstand eifrigsten Studiums ist, wo die Naturwissenschaft geradezu die Wissenschaft des Jahrhunderts genannt werden kann, da bilden die Blumen für so viele die Brücke — leider die einzige — zur großen Mutter Natur.
Auch die Blumen vermögen lange Geschichten zu erzählen vom Keimen und Werden, vom Wachsen und Streben, vom Kämpfen und Vergehen in der Natur. Es sind ja meistens nur einige Blumen, denen unsere Pflege und besondere Liebe gilt, aber diese genügen doch, um uns ein Bild von dem Leben und Treiben der Natur, von ihren Gesetzen und Geheimnissen zu geben. Wer die Blumen liebt, der kennt die Eigenschaften seiner Lieblinge genügend, er verfolgt ihr Werden oft vom Samen an bis zur Blüte, er kennt ihr Wohl und Wehe, ihre ganzen Daseinsbedingungen.
Weniger bekannt ist die Geschichte, die Herkunft dieser Lieblingsblumen, und doch gibt oft erst sie den richtigen Schlüssel für die Beurteilung, für die Behandlung und Pflege einer Pflanze.
Es ist fast selbstverständlich, daß wir mit der Konigin der Blumen, mit der Rose, beginnen.
Ein unsagbarer Zauber liegt über dieser Pflanze, die uns als das Symbol der Liebe gilt, als das Sinnbild der Schönheit und Jugendfrische. Die Rosen bilden ein großes Geschlecht, das viele hundert Arten aufweist, die in den verschiedensten Ländern und auch in Deutschland heimisch sind.
Die Rosen aber, die wir im Garten und in Zimmern züchten, haben ihre Heimat nicht bei uns.
Schon der Umstand, daß sie unsere Winter nicht oder nicht gut ohne Schutzdecke überstehen können, deutet darauf hin, daß sie Kinder südlicher Länder sind.
Am wichtigsten und bekanntesten von allen ist die Gartenrose, die schon in den ältesten Zeiten von den Orientalen gezogen wurde. Bei Griechen und Römern war sie dem Gotte der Liebe geweiht. Schon Homer erwähnt, daß Aphrodite den Leichnam des Hektor mit Rosenöl salbte. Die Römer trieben einen großen Luxus mit Rosen; es gab besondere Rosenhändler in Rom, und von Kaiser Nero wird erzählt, daß er bei einem Gastmahl vier Millionen Sesterzen (weit über eine halbe Million Mark) für Rosen ausgab, die er sich aus Asien kommen ließ.
Die edlen Rosen gelangten zu uns erst zur Zeit der Kreuzzüge, die ja überhaupt zum erstenmal die Schätze des Orients für Europa erschlossen. Es waren dies die sogenannten Damaszener Rosen, die aus Syrien stammen.
Die Zentifolie dagegen hat ihre Heimat in den Wäldern des östlichen Kaukasus und in Persien. Von hier wurde sie nach Rom gebracht und verbreitete sich bald nach allen Ländern, die dem Römerreiche Untertan waren. Nach dem mittleren Europa kam sie jedoch erst ziemlich spät. So ist es bekannt, daß sie erst im Jahre 1322 in England eingeführt wurde.
Aber auch in neuerer Zeit wurden Rosen zu uns gebracht. So kam die indische Rose erst gegen Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts zu uns. Sie wurde die Stammutter der nachher so berühmt gewordenen Bourbon-, Noisette- und Teerosen.
Denn nach und nach begnügte man sich nicht mehr mit den wenigen Rosenarten, die eingeführt wurden. Durch gärtnerische Züchtungen entstanden die mannigfaltigsten Spielarten von verschiedenster Farbe und Form. Und so ungeheuer groß ist das Heer der Spielarten unserer Rosen geworden, daß wir ihrer heutzutage viele, viele Tausende zählen.
Eine besondere Zuneigung fühlen wir zu den Blumen, die kurz nach dem Winter aus ihrem Schlaf erwachen und mit ihrem Erscheinen den ersten Frühling ankündigen.
Der eigentliche Frühlingsbote ist das Schneeglöckchen, das oft genug mit seinen reinweißen anmutigen Hängeblumen noch durch den Schnee des Winters bricht.
Bald darauf folgt das Veilchen mit seinen violetten Blüten, die, unter Hecken und Gebüsch verborgen, sich dennoch durch ihren wunderbaren Duft verraten.
Zugleich mit ihm streckt das Leberblümchen in schattigen Laubwäldern, oft durch den dichten Blatterteppich, den der Herbstwind auf den Waldboden gebreitet, hindurchbrechend, seine hellblauen Blumenkronen hervor.
Diese drei Pflanzen sind in Deutschland einheimisch; seit uralten Zeiten mögen sie hier geblüht haben, lange bevor die Germanen aus Asien kamen und hier sich niederließen.
Wenn man Schneeglöckchen, Veilchen und Leberblümchen als die Blumen des Vorfrühlings bezeichnen kann, so sind Narzissen, Hyazinthen und Tulpen die Prachtpflanzen des eigentlichen Frühlings. So bescheiden und anspruchslos jene drei gewissermaßen das Gemüt des Naturfreundes ergreifen, so imponierend, so stolz und schön fordern diese drei Blumen jeden zur Bewunderung auf. Alle drei sind freilich erst aus fernen Ländern zu uns gekommen.
Sie haben sich allerdings so sehr an unser Klima angepaßt, daß sie bis auf die Hyazinthe, die im Winter eine leichte Schutzdecke verlangt, in jedem Garten freudig gedeihen. Zugleich vermögen diese Blumen aber auch in der trockenen Staubluft des Zimmers zu leben. Diese Eigenschaft weist darauf hin, daß die drei Blumen aus südlicheren Ländern stammen, wo die Luft viel trockener ist und wo es infolgedessen auch viel mehr Staub gibt als bei uns.
In der Tat stammt die Tulpe aus Kleinasien, die Hyazinthe hat ebenfalls da ihre Heimat, aber auch in Persien, in den Pontus-ländern, in der Türkei und in Süditalien, und die Narzisse ist in allen Ländern des südlichen Europa, allerdings auch in Süddeutschland zu Hause.

Abb. 22. Tulpen.
Die Narzisse ist eine schon im Altertum bekannte Pflanze. Wie sehr sie geschätzt wurde, das geht aus der Sage hervor, die mit ihr verknüpft ist. Sie erzählt von dem schonen Narzissus, der sein Bild in einer Quelle sah und von dessen Schönheit so hingerissen war, daß er sich in sich selbst verliebte. Der ohne Zweifel etwas schwärmerisch veranlagte Jüngling wurde von dieser Liebe so mächtig ergriffen, daß er sich vor Sehnsucht verzehrte und dahinsiechte. An der Stelle, wo er starb, keimte die Narzisse hervor.
Auch die Hyazinthe war schon den alten Griechen und Römern bekannt und ebenfalls in ihre Sagen und Mythen verflochten.
Die Tulpe wurde von dem Gesandten des Kaisers Ferdinand I. am türkischen Hofe, Gislen Busbecq, in der Gegend zwischen Adrianopel und Konstantinopel entdeckt und zu uns gebracht. Im Jahre 1560 blühte die erste Tulpe in Augsburg. Der alte Naturforscher Konrad Gesner pflegte sie und beschrieb sie zuerst, daher heißt sie mit ihrem botanischen Namen Tulipa Gesneriana. Sie wurde von Deutschland über alle anderen europäischen Länder verbreitet. Die eifrigsten Verehrer bekam sie in Holland, wo die Liebe zu ihr um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts zu einer wahren Manie ausartete und wo für hervorragende Sorten ganz ungeheure Preise gezahlt wurden.
Fast gleichzeitig oder etwas später als diese Prunkblume des Frühlings treten wieder eine Reihe einheimischer Lieblinge mit ihren Blüten hervor. Es ist vor allem das Stiefmütterchen, das durch gärtnerische Kunst, allerdings auch durch Bastardierung mit ausländischen Arten in edelster Weise verändert, seine Abstammung von dem überall als Unkraut wuchernden dreifarbigen Veilchen kaum noch erkennen läßt.
Auch das Tausendschönchen ist durch sorgfältige Kultur bedeutend verändert worden, während das Vergißmeinnicht, die Primel und das Maiglöckchen beinahe oder auch vollständig noch in der Gestalt vorhanden sind, in der diese Blumen von alters her an den verschiedensten Orten Deutschlands ohne Pflege wachsen.
So einfach und schlicht alle diese Blumen im Vergleich mit vielen exotischen Sommer- und Topfgewächsen sind, so lassen sie sich doch in gewisser Weise gar nicht ersetzen. Gerade im deutschen Frühling, der noch oft im späten Mai von tödlichen Nachtfrösten heimgesucht wird, bedarf der Garten verschiedener Blumen, die auf deutschem Boden gewachsen und mit den Eigentümlichkeiten ihrer Heimat vertraut sind. Allein trotz ihrer verhältnismäßig schlichten Farbenpracht haben gerade diese Blumen es verstanden, sich in das Herz des Volkes einzuschleichen und die Gunst der Poeten zu gewinnen.
Das Vergißmeinnicht als Sinnbild der Treue ist so beliebt wie nur irgendeine andere deutsche Pflanze, das Maiglöckchen hat vielleicht den sanftesten und zartesten Duft aller Blumen überhaupt, das Stiefmütterchen und das Tausendschönchen aber sind gerade in unserer neuesten Zeit durch gärtnerische Kunst zu so hoher Vollendung gebracht, daß sie vielen exotischen Pflanzen ebenbürtig zur Seite gestellt werden können.
Während der Frühling infolge seiner klimatischen Eigenheiten bei uns nur wenig Gartenblumen aufkommen läßt, gewährt der Sommer deren eine unbegrenzte Menge.
Während der heißen Jahreszeit stehen uns ja nicht nur die Blumen zur Verfügung, die die Zierde unserer einheimischen Flora bilden, es kommen noch alle diejenigen hinzu, die in fremden, selbst heißen Ländern blühen und die sich im Sommer bei uns ganz heimisch fühlen.
Mit der Zunahme des Weltverkehrs, mit der Leichtigkeit und Schnelligkeit, die heutzutage selbst leicht verderbende Waren von Erdteil zu Erdteil zu transportieren ermöglicht, ist auch der internationale Austausch von Blumen in ganz bedeutendem Maße gewachsen.
Trotz alledem sind die exotischen Pflanzen doch nur ausnahmsweise zu eigentlichen Lieblingen des Volkes geworden. Sie blieben entweder im Garten des erklärten Blumenfreundes, der alle Neuheiten durchaus haben muß und zu den alten Bekannten sich immer neue erwirbt, oder sie blieben in der Hand des Gärtners, der nach Vorschrift seines Arbeitgebers dessen Villengarten quadratmeterweise mit aparten, natürlich möglichst neumodischen — ganz gleich welchen — Blumen ausstaffieren muß, ebenso wie der Maler quadratmeterweise die Zimmer dekorieren muß. Volkstümlichkeit haben sich daher diese Blumen im allgemeinen nicht erworben. Sieht man sich die Gärten an, die in Dorfern und kleineren Städten von der eigenen Hand der Besitzer gepflegt werden, so findet man eigentlich immer dieselben Blumen. Es sind dies teils ausdauernde Pflanzen, sogenannte Stauden, teils allerdings auch einjährige Sommerblumen, die unsere Winter nicht gut zu ertragen vermögen.
Von den Sommerstauden beansprucht überall die Nelke den ersten Platz.
Die Gartennelke stammt aus Südeuropa; sie war schon den alten Griechen bekannt und wurde bereits von ihnen mit Vorliebe in Töpfen gezogen. Schon Homer erwähnt sie in seinen Gesängen, allein auch der römische Naturforscher Plinius gedenkt ihrer. Trotz dieser südlichen Herkunft gehört jedoch die Nelke zu denjenigen Gewächsen, die sich überall leicht akklimatisieren. Das ist ein großer Vorzug, denn um Volkstümlichkeit zu erlangen, darf eine Blume nicht gar zu große Ansprüche an Boden, Klima und Pflege machen. Eine andere sehr schätzenswerte Eigenschaft ist die große Veränderlichkeit ihrer Farbe. Seit Jahrhunderten haben die Gärtner all ihre Kunst aufgewendet, um Nelken der verschiedenartigsten Färbung hervorzubringen, und noch jetzt treten fast jährlich neue schöne Züchtungen auf von Nelken, die sich durch ihre Farbe vor den bisherigen auszeichnen.
Der wichtigste Reiz der Nelken liegt aber in ihrem Geruch; an Schönheit wird sie vielleicht von anderen übertroffen, ihr Duft aber kann mit dem jeder anderen Blume wetteifern. Es gibt genug Menschen, die den Geruch der Nelken demjenigen der Rose vorziehen. Die meisten aber werden beide gar nicht vergleichen wollen. Die Nelke duftet eben ganz anders als die Rose, die Hyazinthe oder das Veilchen. Hat der Duft des Maiglöckchens etwas außerordentlich Zartes, geht von der Rose ein Hauch edler Vornehmheit aus, so hat der Duft der Nelke etwas Volles, Berauschendes wie schwerer Wein.
Die Nelke ist vielleicht die verbreitetste Zierpflanze, es gibt viele Gärten, in denen Rosen, in denen die gewöhnlichsten Frühlingsblumen fehlen, die Nelke aber fehlt fast nie, nicht einmal in dem kleinsten Gärtchen der ärmsten Leute. Sie kennt keinen Unterschied im Rang, sie ist in den Parken der Reichen vertreten und am Dachstubenfenster des Arbeiters.
Von alters her berühmt ist eine andere Sommerpflanze; die Lilie. Die Lilie, speziell die weiße Lilie, ist eine uralte Pflanze, deren Name mit den ältesten Denkmälern der Geschichte verknüpft ist. Schon in den ältesten Gesängen der Syrer und Perser spielt die Lilie eine Rolle, dagegen ist die Blume, die in der Bibel so oft erwähnt wird, wahrscheinlich nicht die Lilie, da diese Pflanze in Palästina gar nicht vorkommt. Bei den Römern war die Lilie der obersten Göttin, der Juno, geweiht, sie war das Emblem des Thronfolgers und versinnbildlichte die Hoffnung. Sie wird in den ältesten christlichen Sagen erwähnt, ist jedoch erst um 1195 nachweisbar, wo sie im Wappen der Konige Frankreichs vorkommt. Wahrscheinlich war bereits um diese Zeit die Kultur der Lilie im Abendlande weit verbreitet. Jedenfalls spielt im Mittelalter bis in die Neuzeit die Lilie eine hervorragende Rolle im Leben und in der Dichtung der Völker.
In der neuesten Zeit haben diese Blumen jedoch bedeutend an Ansehen und Popularität eingebüßt, besonders wohl darum, weil sie den Vorzug der Veränderlichkeit, den die Nelke in so hervorragender Weise besitzt, gänzlich entbehren. Solange auch die Lilien in Kultur sind, und das sind Jahrtausende, so haben sie sich doch noch nicht im mindesten verändert. Erst neuerdings, seitdem von Japan neue schöne Lilienarten eingeführt werden, scheint die Liebe zu dieser Pflanze wieder zu erwachen.
Keine andere ausdauernde Sommerblume hat bisher so wie Nelken und Lilien die Gunst des Volkes erobern können. Es gibt wohl noch manche, aber sie sind lange nicht so weit verbreitet wie jene, und dann erreichen sie sie nicht im entferntesten an Schönheit oder Wohlgeruch. Eine bescheidene, aber immerhin recht verbreitete Staude ist der Gartenrittersporn, der aus dem Orient zu uns gekommen ist und jetzt in verschiedenen Spielarten die Gärten der Landbewohner schmückt.
Von den einjährigen Sommerblumen sind Reseda und Levkoien die beliebtesten.
Die Reseda stammt aus Nordamerika und wird ebenfalls seit alter Zeit in Gärten, allerdings auch im Zimmer, kultiviert.
Die Levkoie, von denen es zwei Arten gibt, die Sommer- und Winterlevkoie, stammt aus Südeuropa.
Sehr verbreitet in den Garten ist auch der Mohn; die beliebteste Art, der Gartenmohn, stammt aus dem Orient. Aber auch der bei uns einheimische Klatschmohn, der als lästiges Unkraut oft weite Strecken vollständig rot färbt, ist durch gärtnerische Züchtung in viele ansprechende Blumensorten umgewandelt worden.
Später im Sommer blühen die Astern, Sonnenblumen und Georginen, die wiederum so beliebt sind, daß sie fast in keinem Garten fehlen. Die Astern und Georginen sind infolge ihrer ganz unglaublichen Veränderungsfähigkeit noch nicht aus der Mode gekommen, obwohl sie weder Geruch, noch bisher eine besonders auffallende Schönheit besitzen. Erst neuerdings sind von beiden so wunderschöne Varietäten gezüchtet worden, daß sie fernerhin mit größerem Rechte auch in den prunkvoll angelegten Gärten einen Platz beanspruchen dürfen.
Die Gartenaster ist erst im vorigen Jahrhundert, etwa 1730, aus China bei uns eingeführt worden. Im Jahre 1728 gelangte der erste Samen dieser Aster nach Paris, wohin ihn der französische Missionar P. Incarville aus China schickte. Damals war die Blüte dieser Blume noch ganz einfach, sie glich dem Gänseblümchen, hatte eine gelbe Scheibe und weiße Strahlenblüten. Danach traten rote Astern auf, im Jahre 1834 zum erstenmal eine violettfarbige, aber erst im Jahre 1850 hatte man durch gärtnerische Kunst die ersten wirklich gefüllten Astern erlangt.
Ebenso wie diese war auch die Georgine zunächst einfach, als sie von ihrem Vaterlande Mexiko im Jahre 1789 nach Spanien gelangte. Von hier aus wurde die Georgine nach allen Ländern Europas gebracht; ums Jahr 1800 war sie in Dresden bekannt, und Humboldt sandte sie im Jahre 1804 direkt aus Mexiko nach Berlin.
Seit dieser Zeit ist die Georgine in so mannigfachen Züchtungen aufgetreten, daß man von ihr schon Tausende von Spielarten kennt.
Weniger verändert ist die zu derselben Familie der Korbblütler gehörige Sonnenblume, die bis spät in den Herbst hinein, oft bis November, noch ihre großen, weithin strahlenden Blütenköpfe entfaltet. Sie wurde bereits im Jahre 1569 nach Europa gebracht, und zwar stammt sie ebenfalls, wie die Georgine, aus Mexiko, doch kommt sie auch in Peru wild vor.
Ganz andere Bedingungen als die Gartenblumen haben die Zimmerblumen zu erfüllen.
In einem trockenen, allzeit gleichmäßig warmen, häufig von Staub erfülltem Räume, wie es ein Zimmer ist, können meistens nur solche Blumen gedeihen, die aus trockenen, heißen Ländern stammen. Da aber dort die Pflanzen meist üppiger gedeihen und schöner gestaltet sind als bei uns in der nördlich gemäßigten Zone, so übertreffen viele im Zimmer fortkommende Blumen bei weitem ihre im freien Lande wachsenden Schwestern. Allerdings sind eine Menge unserer beliebtesten Gartenblumen zugleich geschätzte Zimmerblumen. Dies ist vor allem der Fall mit der Rose, der Nelke, Tulpe, Hyazinthe, Reseda und Levkoie. Die meisten jetzt beliebten Topfblumen sind jedoch erst verhältnismäßig neue Einführungen.
Am häufigsten von allen Pflanzen sieht man jetzt an den Fenstern Pelargonien und Fuchsien. Die Pelargonien, die ihre Beliebtheit wohl am meisten ihrer Anspruchslosigkeit in der Pflege verdanken, sind in Südafrika heimisch. Sie wurden besonders im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts Modeblumen, danach sind sie jedoch aus der feineren Zimmergärtnerei verschwunden, sie sind aber neuerdings auch da wieder beliebter geworden, seitdem in England neue interessante Formen und Spielarten gewonnen wurden.
Von den Fuchsien gibt es sehr viele Arten; die erste, die dreiblättrige Fuchsie, wurde gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts von dem Pater Plumier aus Amerika herübergebracht. Spater wurden neue Arten entdeckt, sogar noch in neuester Zeit fand man deren in Mexiko, Peru, Chile, aber auch in Neuseeland. Durch Kultur sind außerdem nach und nach eine Menge Vermischungen der einzelnen Arten und viele Nuancierungen entstanden.
Diese beiden Zimmerpflanzen sind so verbreitet und so allgemein zu finden, daß man sie fast vulgär nennen könnte. Etwas weniger häufiger sieht man das Vanillen-Heliotrop, vom Volke häufig nur Vanille genannt, eine Blume, die aus Peru stammt.
Nicht mehr so verbreitet und so beliebt wie ehemals sind heutzutage die stolzen Kamelien. Sie wurden im Jahre 1739 von dem Jesuiten Georg Camelius aus Japan nach Europa gebracht. Ihre Heimat hat die Kamelie in China und in Japan, wo man aus ihren Samenkörnern ein Oel gewinnt. Aus beiden Ländern wurden in späterer Zeit neue Varietäten eingeführt, und als vollends solche in europäischen Gärten auch die Fruchtreife erlangten, zog man hier aus Samen neue herrliche Formen. Zunächst wurde die Kamelie hauptsächlich in England kultiviert, dann kam sie nach Italien, Frankreich, und jetzt wird sie besonders in Amerika gepflegt.
Eine sehr liebliche Pflanze ist die sogenannte indische Azalie (Azalea indica), deren zarte Blüten bereits im allerersten Frühling unsere Zimmer schmücken. Es gibt verschiedene eng verwandte Arten, die aber alle aus China und Japan stammen, wo sie an den Böschungen kleiner Gebirgsflüsse, gegen die heißesten Sonnenstrahlen geschützt, wachsen. In den Niederlanden, die in früheren Jahrhunderten der klassische Boden der Blumenzucht waren, wurden die Azalien schon im siebzehnten Jahrhundert gepflegt. Später gelangten sie nach England und in die übrigen Länder des europäischen Kontinents. In neuerer Zeit wurden aus den beiden ostasiatischen Reichen neue Arten eingeführt, und außerdem wurden auch in Europa durch Züchtung herrliche Spielarten gewonnen. Aus den Ländern am Schwarzen Meer kommen dagegen die sogenannten pontischen Azalien.
Aus jenen gleichen japanisch-chinesischen Ländern stammt auch die Hortensie, die im Jahre 1790 von dem um die Botanik hochverdienten Reisenden Banks nach Europa gebracht worden ist. Ihre schönen rosafarbigen kugeligen Blutendolden können blau gefärbt werden, wenn man der Pflanze eisenockerhaltige Erde gibt oder auch nur sie mit Wasser begießt, in dem längere Zeit altes Eisen gelegen hat.
Seit lange schon sind die Zyklamen oder Alpenveilchen bei uns als Topfpflanzen eingeführt, wahrscheinlich wurden sie schon im siebzehnten Jahrhundert bei uns im Zimmer kultiviert. Man kennt verschiedene Arten, wovon eine, das europäische Alpenveilchen, an verschiedenen Stellen der deutschen Alpen wächst, also eine einheimische Pflanze ist, während das sogenannte persische wahrscheinlich aus Asien stammt. Der lange und zum Teil zur Winterszeit stattfindende Flor hat diese Blume sehr beliebt gemacht, um so mehr, als sich durch sorgfälttge Züchtung auch schr effektvolle Varietäten ergeben haben.
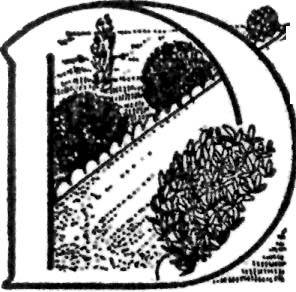
er Garten ist mehr denn irgendein anderes Besitztum, das der Kulturmensch sein eigen nennt, ein Stück Natur, aber auch er ist doch angelegt und wird unterhalten vom Menschen und tragt darum ebenso den Stempel seines Schöpfers wie irgendein anderes Werk.
Es ist darum nicht zu verwundern, daß auch im Garten mehr oder minder der Charakter der Zeit sich offenbart.
Mag jener immerhin eine Stätte der Ruhe und Erholung, des stillen Genusses sein, so trägt doch der Mensch seinen Geschmack, seine Stilrichtung direkt oder indirekt in seinen Garten hinein. Und dieser hat wirklich einen Stil, es gibt einen ausgeprägten Gartenstil heutzutage, ganz im Gegensatz zu so vielen anderen Werken der gegenwärtigen menschlichen Tätigkeit, die nur zu oft an Zersplitterung, Zerfahrenheit, Gedankenlosigkeit leidet.
Die Gartenkunst hat verschiedene Berührungspunkte mit der Landschaftsmalerei. Sie gehört zwar nicht eigentlich zu den Künsten, aber sie ist doch auch mehr als ein Kunsthandwerk.
Die Gartenkunst hat keine praktischen Absichten — wenigstens nicht mehr als zum Beispiel die Baukunst — sie will durch bestimmte Gruppierung von Landschaftsbildern ästhetische Genüsse erzeugen.
Wie diese Landschaftsbilder zusammengestellt werden, das ist eben Sache des Stils, danach unterscheiden wir den französischen, den englischen und den holländischen Gartenstil. Auch unsere Zeit hat ihren Stil. Man kann vielleicht nicht sagen, daß dieser gerade einen Grundzug der Zeit träfe oder daß er den Intentionen entspräche, die ernste Jünger dieser Kunst hegen. Aber es ist der herrschende Stil, der jetzt gegebene, an den wir uns halten wollen ohne Rücksicht auf Neuerungsbestrebungen, die auch hier nicht fehlen.

Abb. 23. Motiv aus dem Englischen Garten in München.
Die heutige Gartenkunst ist hervorgegangen aus dem englischen Gartenstil, der bekanntlich gegenüber dem steifen französischen Geschmack der Natur volle Freiheit zu lassen strebte.
Hatte dieser den Bäumen, Sträuchern, Wegen, der ganzen Landschaft alle Individualität genommen, indem er sie gerade, rechtwinkelig, gleichförmig zuschnitt, so ließ der englische Gartenstil jeden Baum, jeden Strauch so wachsen, wie er wachsen wollte, er ordnete die Pflanzengruppen ebenso unregelmäßig und ließ auch die Wege natürlicher verlaufen.
Der heutige Gartenstil ist nun zwar ein Kind des englischen und doch neigt er in seinen Tendenzen merkwürdigerweise zu französischem Zwang. Unser Gartenstil ist nämlich durch und durch der Ausfluß gesellschaftlicher Etikette, ähnlich wie der französische es war. Der Garten des Reichen soll ein Prunkstück sein, ebenso wie seine Villa, wie seine Salons. Der kleine Mittelbürger, der heutzutage selbst keinen eigenen Geschmack hat, ahmt jenen nach, soweit sein Garten nicht praktischen Zwecken dient, ebenso wie ihm auch sonst die Sitten der vornehmen Gesellschaft als Vorbild dienen.
Es herrscht heutzutage keine Naturschwärmerei wie zu Zeiten Rousseaus und Goethes, eine Liebe zu ihr, ein Aufgehen in ihr, das eben den französischen Stil verdrängte und den natürlichen, sagen wir den damals natürlicheren englischen Stil schuf.
Der heutige Villagarten, sei er nun wirklich Garten zu einer Villa oder Anlage in einer Stadt, um einen Bahnhof, ein Etablissement ist nicht Selbstzweck mehr, er ist ein Stück Putz, eine beliebte oder unentbehrliche Dekoration für irgendwelchen Wohnplatz oder Aufenthaltsort.
Unsere Zeit würde es ja wohl nicht vertragen, wenn man alle Bäume in der Weise zu senkrechten Wänden verschnitte, wie die französische Gartenkunst es tat. Dazu hat sie schließlich denn doch einen zu geschärften Blick für die wunderbare Mannigfaltigkeit der Formen, des Wuchses, des ganzen Aussehens der Bäume. Auch der naturwissenschaftlich Ungebildete — und das sind fast alle Gebildeten — weiß oder ahnt etwas von dem Unterschiede im Aussehen einer Eiche, einer Kastanie und einer Akazie, und ein Etwas empört sich in ihm bei dem Gedanken, alle drei gleichmaßig zu verschneiden, daß sie dastehen wie die vierkantigen Hölzer aus einem Baukasten.

Abb. 24. Motiv aus Sanssouci.
Also ganz so grob wird man sich jetzt gegen die Natur nicht vergehen, zumal der Abscheu vor dieser steifen Naturverstümmelung in allen Büchern zu lesen ist. Aber die heutige Gartenkunst läßt trotzdem der Natur keineswegs freien Lauf, ja man muß sagen, sie stutzt und schneidet sie durchaus zu ihren Dekorationszwecken zu.
Ein großer Teil, häufig der größte Teil eines jeden modernen Gartens besteht aus Rasenflächen. Sie bilden gewissermaßen den Hintergrund, von dem sich die Figuren wirkungsvoll abheben. Der Rasen mit seinem lichten Grün und seiner eleganten Gleichmäßigkeit soll einen Ueberblick über die Gesamtheit der Gartengrundstücke gewähren, er soll besondere Prachtstücke von den übrigen Pflanzengruppen trennen, und er soll eine Menge Durchblicke durch einzelne Baum- und Strauchpartien gewähren und damit den Garten mannigfaltiger, reicher und größer erscheinen lassen, als er ist. Insofern spielt also der Rasen eine sehr wertvolle Rolle.
Nun sehe man sich aber den Rasen selbst an.
In der Natur wird man einen solchen nirgends finden.
Er besteht nämlich aus nichts anderem als einer Unmasse ganz gleichförmiger, mit der Mähmaschine kurzgeschnittener Grashälmchen. Ein Grashalm gleicht genau dem anderen, zwar sind es möglicherweise gegen vier verschiedene Grasarten, die zur Aussaat für den Rasen verwendet wurden, aber selbst diese Verschiedenheit der Graspflanzen ist nicht bemerkbar, da ja alle bis auf etwa zehn Zentimeter Höhe niedergeschnitten worden sind.
In der Natur würden diese Gräser eventuell die Höhe von einem halben Meter erreichen, sie würden im Sommer ein voneinander höchst verschiedenes Aussehen infolge ihrer Blutenstände haben, deren reizende Formen ja zum Teil in toter, getrockneter Ware von den Makartbuketten her bekannt sind. In der Natur aber sind auf einer Waldwiese, auf einer Gebirgsmatte, in einem Flußtale die verschiedenartigsten Gräser und Halbgräser vorhanden und überdies mit einer bunten, unendlich mannigfaltigen, mit jeder Woche sich ändernden Fülle von Blumen durchwirkt. So sieht der natürliche Rasen aus, und was ist der Zierrasen?
Sicher ist er alles andere als Natur, ja, man muß sagen, er ist französisch durch und durch, er ist eine Zurechtschnitzung der Natur, wie sie Lenôtre im Versailler Park nicht anders vorgenommen hat.
Denken wir uns einen Wald, der aus nur vier Baumarten besteht. Schlägt jemand diesen Bäumen die Krone und den oberen Stammteil bis auf etwa zwei Meter Höhe ab, so hat man ein deutliches Abbild von der Art und Weise der Pflanzenbehandlung, die den modernen Zierrasen geschaffen. Vielleicht wird einmal ein solcher Wald, der nur aus Baumstümpfen bestünde, Mode, im Prinzip wäre er wenigstens nichts Neues mehr. Jedenfalls zeugt der Zierrasen von allem anderen, nur nicht vom Sinne der Naturschönheit. Und das muß man bei Beurteilung der heutigen Gartenkunst berücksichtigen.
Ihr oberstes Prinzip ist keineswegs, die Eigenheiten der Natur im Spiegel der Schönheit aufzufangen, sondern gewisse Schönheitsformen der eleganten Welt vermittels der Natur auszudrücken.
Der geschorene Rasen macht einen äußerst eleganten, sauberen, geschniegelten, wohlerzogenen Eindruck, wie ein neuer Frack. Beim Ball ist der Frack das Mittel, die „Eleganz” zum Ausdruck zu bringen, im Garten ist es der Zierrasen.
Was wollte Ludwig XIV. mit dem Versailler Park, dem gewaltigen Gartenwerk, das jener Lenôtre einst mit den Millionen eines kunstsinnigen Königs geschaffen hatte?
Man denke sich dieses unermeßliche Schloß, gegen welches das Berliner ein Kinderspielzeug ist, ohne die berühmten Gartenanlagen!
Also zunächst war der Park notwendige Staffage zum Schloß. Andere suchen sich eine schöne Gegend aus und bauen dahin ein Schloß. So mächtig aber, so riesenhaft war der Wille des Königs, daß er, nachdem er das gigantische Schloß geschaffen, auch die schöne Gegend dazu schuf. So ist der große Versailler Park auch zugleich als Landschaft beabsichtigt.
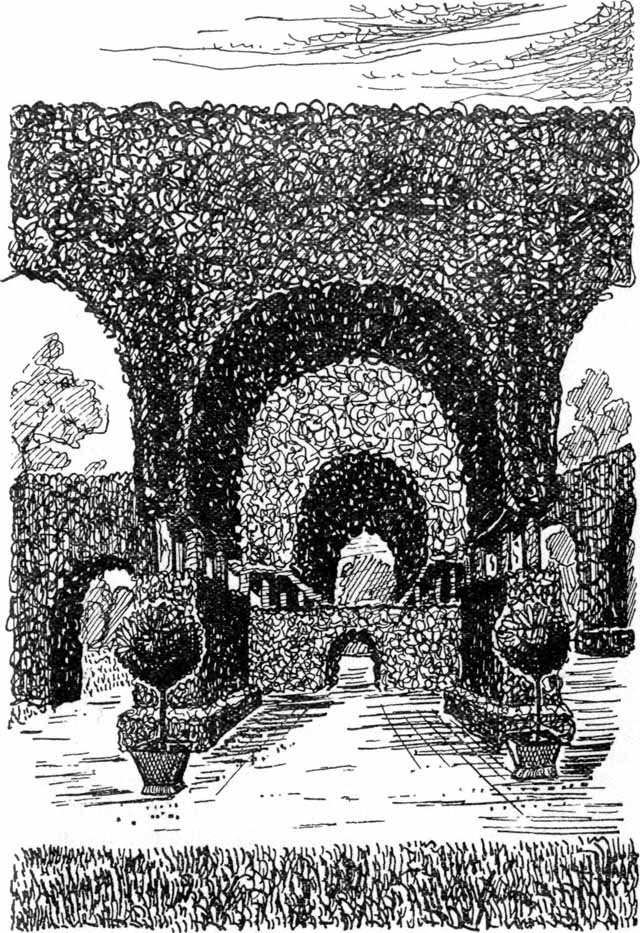
Abb. 25. Versailler Park.
Allein es ist eine Landschaft, wie sie nicht der Natur abgelauscht und aus der Natur heraus geformt ist, sondern eine Landschaft, wie sie sich vor dem Hofe sehen lassen kann. Am Hofe der Fürsten sind meistens uniformierte Kleider vorgeschrieben, uniforme Haltung, uniforme Manieren. So ist es auch mit dem Versailler Park. Sämtliche Bäume stehen in uniformem Habitus da, alle Individualitat ist von ihnen gewichen, die Kastanie ist ebenso gradwinklig verschnitten wie die Eiche, die Wege sind gerade oder bilden regelmäßige Figuren, der gewaltige künstliche Wasserarm, lang wie ein Fluß und breit wie ein See, ist zu einem kreuzförmigen Kanal geworden, schnurgerade wie ein Lineal.
Diese Steifheit, Geradlinigkeit, Uniformierung tritt überall auf, wo die Vornehmheit, Eleganz, Wohlerzogenheit der feinen Welt herrscht.
Will man also ein Stück Natur haben, ist man in der Lage, es selbst zu schaffen, so wird es in die Schleifmühle dieser gesellschaftlichen Tugenden gesteckt, um dann als echtes Salonstück wieder zum Vorschein zu kommen.
So ist es mit dem Versailler Park, so ist es auch mit dem heutigen Garten.
Außer dem Zierrasen ist es besonders die Form und Bepflanzung der Blumenbeete, die direkt von gesellschaftlicher Etikette diktiert sind.
Da kommen überall regelmäßige Figuren, Kreise, Ovale, symmetrische Arabesken aller Art vor, sodann aber sind die Blumen auf den Beeten selbst wieder sehr künstlich und regelmäßig arrangiert, sie stehen immer da in Positur wie in einer Quadrille à la cour. Die Gesellschaft verlangt eine fertige Toilette. So dürfen sich denn die Blumen nicht etwa im Garten selbst entwickeln, nein, sie werden in besonderen Warmhäusern oder versteckten Warmbeeten angezogen und dann, wenn sie anfangen zu blühen, werden sie ausgepflanzt. Sind sie dann im Abblühen, so werden sie entfernt und frische blühende Blumen an ihre Stelle gesetzt. Ob es da nicht junge Mädchen gibt, die der Meinung sind, die Blumen kommen gleich blühend zur Welt?
Die Entwicklung der Blumen, das Hervorschießen immer neuer Arten zu einer bestimmten Jahreszeit, um andere zu verdrängen, das ganze so interessante Spiel der Natur kann den Besitzer und Villeninhaber nicht interessieren, es entspricht nicht den gesellschaftlichen Anforderungen, da man immerfort blühende, gut gruppierte Blumen verlangt.
Der Zierrasen ist nicht das einzige Beispiel des Pflanzenverschneidens.
Auch andere Pflanzen als Gräser werden im modernen Garten mit der Schere behandelt. Es sind dies solche, die zur Bildung eines sogenannten Teppichbeetes dienen.
Hier sollen vermittels der verschiedenen Farben der Pflanzen mosaikartig zusammengesetzte Muster erzeugt werden, ähnlich wie auf einem Teppich oder einem Fliesenfußboden. Jede Pflanze bildet dabei sozusagen einen Mosaikstein. Wie diese sehr gleichförmig behauen, so muß jede Pflanze sehr gleichmäßig geschnitten werden, damit sie nicht über den ihr angewiesenen Punkt des Bildes hinausgreife und dieses dadurch zerstöre. Sie darf nicht nach den Seiten, sie darf auch nicht hoch wachsen, sie wird also vorn, hinten, rechts, links und oben beschnitten. Alle Pflanzen vertragen eine solche Prozedur nicht, es gibt also besondere Teppichpflanzen. Es sind meistens Blattpflanzen, deren Blätter durch gärtnerische Zucht von dem normalen Grün abweichen und ein Gelb, Silbergrau, Dunkelrot angenommen haben. Einige von ihnen würden auch blühen, wie z. B. Pyrethrum, ihr Blütenansatz wird aber beizeiten weggeschnitten. Die Pflanzen, diese in Wuchs, Haltung, Entwicklung, Blatt- und Blütenformen so verschiedenen Wesen, sind hier bloße Farbenträger geworden, bestimmt, als Mosaiksteine ein Dekorationsmuster zu bilden. Aber die Sache sieht elegant aus.
Es kann beiläufig darauf hingewiesen werden, daß der Stil Ludwigs XIV. die Pflanzen wenigstens hoch wachsen ließ, d. h., sie wurden ja oben auch horizontal geschnitten, aber der Schnitt wurde doch jedes Jahr höher geführt. Heutzutage wird alles niedergehalten, der Rasen darf nicht über zehn Zentimeter hoch werden, auch die Teppichbeetpflanzungen sind um so begehrter, je niedriger sie gehalten werden können.
Die Blattpflanzen für Teppichbeete erhalten in der Mehrzahl durch gärtnerische Züchtung eine vom natürlichen Grün abweichende Färbung. Nichts kennzeichnet vielleicht mehr die heutige Gartenkunst als die künstliche Züchtung.
Kurzgeschorenen Rasen, Teppichbeetpflanzen können wir uns noch eher auch für die Gesellschaft einer früheren Zeit passend denken. Die künstliche Züchtung aber ist wie die Theorie von der natürlichen Zuchtwahl ein Kind unserer Zeit.
Zwar haben schon in früheren Jahrhunderten die Gärtner sich damit beschäftigt, neue Sorten von Tulpen, Hyazinthen und einigen anderen Blumen durch Kreuzung und Auslese interessanter Varietäten zu züchten, aber von der systematischen Weise, wie jetzt die Züchtung geschieht, hatte man damals keine Ahnung; damals wurde sie nebenbei betrieben, jetzt ist sie Charakterzug des Gartenhandwerks und des Gartenstils.
Alle Gebiete, die in den Wirbelwind der Konkurrenz und der vornehmen Gesellschaft geraten, sollen nicht sowohl Neues bringen als Neuheiten, „Nouveautes”. So ist es auch mit der Gartenkunst. Irgend jemand züchtete eine Zwergform der gewöhnlichen Aster, sofort verschwanden die hohen Astern aus allen Villengärten und an ihre Stelle traten die Zwergformen.
Jeder Katalog einer Handelsgärtnerei oder Baumschule enthält eine Serie Neuheiten, die fast durchweg gärtnerische Züchtungen sind.
Die Freude und der Stolz der Gärtner sind nicht gering, wenn es ihnen gelungen ist, wieder eine einfache Blume gefüllt zu machen. Angeblich wird durch die Füllung der Effekt einer Blume erhöht, in Wahrheit wird ihr dadurch alle Individualität genommen. Tatsächlich ist es auch kaum möglich, eine gefüllte Aster, Zinnia, Bellis, Skabiose usw. voneinander zu unterscheiden.
Das Auffälligste der heutigen Züchtung sind aber vor allem die buntblättrigen Pflanzen. Da gibt es Eichen mit gelben Blättern, einen Feldahorn mit weißgescheckten Blättern, eine Birke mit purpurfarbiger, eine Traubenkirsche mit gelbmarmorierter Belaubung. Durch diese Buntheit des Blätterschmuckes erhält der heutige Villengarten etwas zierlich Dekoriertes, wie ein mit Fahnen behängter Festsaal. Seine Salonfähigkeit wird erhöht, aber der Charakter ist hin.
Weniger auffällig sind die Züchtungen, durch welche die ursprünglichen Blattformen der Pflanzen verändert werden. Es gibt eine Esche mit Blättern, wie sie der Weißdorn hat, eine andere mit der Belaubung der Weide, eine Sommeresche mit Farnkrautblättern, noch besser: eine Erle mit Eichenblättern und eine Eiche mit Erlenblättern. Dergleichen Züchtungen gibt es eine Menge, alle frönen dem Sensationsbedürfnis, dem die Zeit huldigt.
Ebenso große Buntheit wie durch die Züchtungen wird durch den Import ausländischer Pflanzen erzeugt.
Der Verkehr, der heutzutage die Salons der Reichen mit Luxusartikeln aus allen Erdteilen überschüttet, hat auch auf dem Gebiete der Gartenkunst seinen unermeßlichen Einfluß ausgeübt. Aus allen Ländern und Erdteilen sind Pflanzen zu uns gekommen und haben die einheimischen fast ganz verdrängt. Japanische, nordchinesische und nordamerikanische Bäume und Sträucher bilden die eigentlichen Hochgruppen unserer Villengärten, neben ihnen aber stehen die im Winter schutzbedürftigen Rhododendren und Azalien der Pontusländer, die zarten Heidekrautgewächse vom Kap, die Kakteen aus Mexiko, ja die Palmen der Tropenländer. Wird der Naturkenner bei dieser Zusammenwürfelung von Ländern und Zonen an die Gruppierung von Pflanzen in einem Blumengeschäft erinnert, so wirkt sie doch auf den Nichtkenner — und das sind die meisten — ganz kurzweilig, apart, vornehm, elegant. Und das ist ja der Eindruck, der hervorgerufen werden soll.
Die Zusammenstellung von Pflanzen aus den verschiedensten Ländern und Zonen, aus den verschiedensten Klimaten, Bodenarten und Höhenlagen würde man in jedem anderen Falle stillos nennen, für den heutigen Stil des Villengartens ist sie charakteristisch, sie paßt zu ihm. Wo Eleganz die angestrebte Schönheitsform ist, da wird es nur richtig sein, die effektvollsten Bäume, Sträucher und Blumen aus allen Ländern zusammenzusuchen und daraus eine zierliche internationale Gesellschaft herzustellen. Daß dadurch die inneren Gesetze der Pflanzengruppierung auf den Kopf gestellt werden, daß dadurch keine echten, natürlichen Landschaftsbilder hervorgebracht werden können, ist selbstverständlich.
Eine sogar für Naturunkundige mißliche Nebenwirkung hat übrigens diese Verwendung von zarteren ausländischen Pflanzen: sie müssen im Winter zugedeckt, mit Gestellen und Strohgeflecht umgeben werden, so daß dann ein solcher Villengarten aussieht wie eine Sammlung von Mumien und Gräbern.
Die Villengarten unserer Zeit sind meistens noch jung; Villen in Mengen, besonders in der Nähe großer Städte, wurden ja erst in den letzten Jahren gebaut, ihre Gärten sind also ebenfalls noch nicht lange angelegt. Die Bäume sind infolgedessen noch jung, von der Urwüchsigkeit eines alten Parkes oder eines Waldes haben sie nicht das geringste, sie sind zierlich, niedlich — elegant.
So trägt selbst das geringste Alter der Anlage dazu bei, einen Gartenstil zu schaffen, in dem die Natur dazu benutzt worden ist, Stimmungen, Gefühle der Eleganz hervorzurufen. Der Villenstil unserer Zeit hat somit ein durchaus festes Gepräge. Aehnlich wie der französische nimmt er der Natur ihre Eigenart, aber es ist ihm vorzüglich gelungen, die Eleganz, welche der heutigen vornehmen Gesellschaft als Ideal vorschwebt, zum Ausdruck zu bringen.
Wir wollen bei alledem nicht zu pessimistisch schließen.
Aller Voraussicht nach gehen wir einer Zeit entgegen, wo der Garten auch in gesunderem Sinne wieder zu Ehren und Ansehen kommen wird. Die Bestrebungen, Gartenstädte nach englischem Vorbild zu gründen, deuten diesen Zug schon an, die Entwicklung der Großstadt drängt darauf hin. Das ungesunde Leben der heutigen Zeit sucht in mancherlei Sport ein Gegengewicht gegen die bewegungslose, nervös machende Tätigkeit in Bureau, Geschäft und Studierstube. Der Garten braucht nicht nur den Geist anzuregen, er wirkt auch auf das Gefühl, das Gemüt. In einem Garten wählt und gruppiert jeder die Pflanzen nach seinem eigenen Geschmack. Von der kleinen Pflanzenwelt seines Gartens sieht er sich weggetragen in das große Reich der Allnatur, in das Hohe und Heilige, das jede Kunst anders benennt und zu dem doch jede, wenn auch auf besonderem Wege, hinzuführen sucht.
XI. DER MENSCH ALS GESTALTENDE MACHT IN DER NATUR (VON WILHELM BÖLSCHE)

enn die von der Mehrzahl heutiger Naturforscher geteilte Meinung recht hat, so ist der Mensch in jener erdgeschichtlichen Periode entstanden, die man als die Tertiärzeit bezeichnet. Das Wort, von lateinisch tertius, der dritte, abgeleitet, besagt etwa soviel wie das dritte Hauptweltalter in der bekanntlich nach vielen Millionen Jahren zählenden Entwicklung der bereits von Tieren und Pflanzen bewohnten urweltlichen Erde.
Jedenfalls stand sie uns beträchtlich näher als die eigentlich romantischen Urweltstage etwa der alten Steinkohlenwälder oder der berühmten Saurier vom Reptilgeschlecht. Entsprechend dieser zeitlichen Nähe ähnelte ihr Naturbild sehr stark schon dem heute vorhandenen, Meere und Länder stellten sich in ihrem Verlauf fast ganz auf die gegenwärtigen Kartengrenzen ein, unsere größten Hochgebirge vollendeten sich in ihr, und Tier- und Pflanzenwelt nahmen mehr und mehr unseren Charakter an. Insbesondere war es die oberste Gruppe der Wirbeltiere, die der Säugetiere, die in ihr überall einen gewaltigen Aufschwung nahm &mdash wobei ein lange noch sehr mildes Klima fast auf der ganzen Erde entgegenkam.
Aus diesen Säugetieren denken wir uns nun auch den Menschen selbst damals hervorgegangen, wofür die gewichtigsten Gründe seines noch fortbestehenden Körperbaues sprechen, wenn auch tertiärzeitliche Knochenreste seiner engeren Vorstufen bisher nicht gefunden worden sind. Ob der Termin der Entstehung bereits tief in der Zeit selbst lag oder erst nahe ihrem Ende, wissen wir nicht. Jedenfalls aber zeigt das gesamte uns überlieferte tertiäre Naturbild in keinem Punkte noch irgendein Anzeichen einer bereits erfolgten Beeinflussung durch ihn, obwohl die Tertiärperiode in sich noch recht beträchtlich lang war und sicherlich auch mehrere Millionen von Jahren umfaßte.
Wenden wir den Blick aber jetzt von damals zu unserer Gegenwart herüber, so belehrt uns wieder der sachkundige Forscher, daß die seither nochmals verflossene Zeitspanne keineswegs im Verhältnis eine sehr große gewesen sein kann. Im äußersten Maße wird man sie kaum auf ein paar hunderttausend Jahre ansetzen dürfen, was mit geologischen Ziffern gemessen sehr wenig ist. Und nun doch heute: was für ein gänzlich verändertes Bild.
Noch immer dauern bei uns in den Grundzügen des ursprünglich gegebenen Naturbildes der Erde (wenn man von einigen Einzelheiten etwa des Klimas absieht) wesentlich tertiärzeitliche Verhältnisse fort, ganz entsprechend so kurzem Zwischenraum. Aber überall im Mittelpunkt steht gegenwärtig an sichtbarster Stelle jenes eine damals so verborgen zunächst auftauchende merkwürdige Wesen: der Mensch selbst.
Dieser Mensch, einst aus der Natur hervorgegangen, hat sich inzwischen selber, möchte ich sagen, zu einer geologischen Macht auf dieser Erde entwickelt.
Seine künstlichen Kanäle trennen heute Erdteile voneinander, seine Tunnels durchbohren das dickste Gebirgsmassiv, seine Telegraphenkabel liegen wie eine Art Nervensystem in den Abgründen der Tiefsee zwischen Kontinent und Kontinent. Die Tier- und Pflanzenwelt aber steht zu ihm längst nicht mehr in dem einfachen Verhältnis wie sonst zu einer einzelnen Art im hergebrachten Naturhaushalt — wie an vielen Stellen dieses Buches geschildert ist, ist sie wenigstens auf Ungeheuern Erdstrecken bereits in einen ausgesprochenen Allgemeinzustand der Abhängigkeit getreten, der uns von einer sieghaften Herrschaft auch hier des Menschen reden läßt. Ohne jede phantastische Übertreibung glaubt man heute schon sagen zu dürfen, daß in ziemlich absehbarer Zeit von dieser gesamten Tier- und Pflanzenwelt nur noch vorhanden sein und weiterdauern wird, was dieser Mensch für seine eigenen Absichten gebrauchen kann und deshalb duldet. Hoffen wir, daß das auch dann noch eine recht stattliche Summe sein wird, ausgelesen nicht bloß auf engere rohe Nützlichkeit, sondern auch im Sinne von feinem Naturgefühl und wissenschaftlichen Zielen. Aber tatsächlich wird es eben nur noch das sein, was der Mensch will.
Was für eigenartige Ursachen haben nun in so verhältnismäßig, wie gesagt, kurzer Zeit zu diesem ganz kolossalen und fundamentalen Umschwung geführt? Der sich durchsetzenden Erdregie eines einzelnen Lebewesens, das zunächst wohl nur ganz schlicht neben die anderen noch in jener Tertiärzeit getreten war?
Und die Frage wird sofort noch merkwürdiger, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß selbst jene Spanne Zeit dazu von ein paar hunderttausend Jahren tatsächlich auch noch zum weitaus größten Teile hingegangen ist, ehe gerade diese heute entscheidende Sache sich durchzusetzen begann.
Es lag dort zunächst nach Ausklang der Tertiärzeit selbst noch das sonderbare klimatische Intermezzo der sogenannten diluvialen Eiszeit. Aus ihr haben wir jetzt zwar sehr deutliche Spuren des Menschen, aber eben diese Spuren verraten uns bis zu ihrem Schlüsse auch einen noch so primitiven Menschen, daß vom Beginn jener Erdherrschaft immer noch keine Rede sein konnte.
Wir sehen ein Lebewesen, das sich zwar bereits mit sehr merkwürdigen Mitteln behauptet, aber immer doch wesentlich noch „behauptet”, ohne die Dinge schon selbsttätig umzukrempeln. Und erst nach Ausklang dieser Eiszeit glauben wir auf die wirklichen ersten Anzeichen auch dieses beginnenden Umkrempelns selbst zu schauen.
In Wahrheit ist aber die Zeit damit nochmals so eingeschränkt, daß nur noch einige zwanzigtausend Jahre für diesen wirklichen Prozeß übrig sind. Und selbst darin läuft noch ein Teil, mehr als die Hälfte, trotz allerhand Indizien ziemlich dunkel, bis endlich die letzten zehntausend Jahre der engeren „Kulturgeschichte” den deutlichen Fluß im Lichte zeigen. Und auch darin muß noch eingeschränkt werden, denn der endgültig entscheidende Ruck liegt, wie wir alle wissen, eigentlich erst in den allerletzten paar Jahrhunderten. Also ein geradezu ungeheures Tempo, wenn man sonst auf geologische und Lebensentwicklungen blickt. Unwillkürlich also und vollends die Frage: wie konnte so etwas möglich werden — solches Uebergewicht einer einzelnen Lebensform in so winzigem Zeitraum . . .?
Und hier muß nun zunächst etwas bedeutsam werden, was wir ganz in der Stille in jener Tertiärzeit selbst doch schon hätten beobachten können, falls uns von dort menschliche Spuren überhaupt erhalten wären — was aber bei den ersten wirklich sichtbaren Anzeichen menschlicher Arbeit während jener Eiszeit sich sofort aufdrängt.
Der Mensch dieser Eiszeit herrschte noch nicht innerhalb der irdischen Natur — aber er arbeitete doch schon in ihr, und zwar arbeitete er sogleich in einer äußerst charakteristischen Weise, die, recht besehen, nach dem oft gebrauchten Wort ihm bereits den künftigen Lenkerstab gleichsam in den ersten schlichten Arbeitsranzen legte.
Auch der Mensch änderte, wie die meisten Tiere jener Tage, seinen eigentlichen Körper in jener Eiszeit nur noch wenig oder schließlich gar nicht mehr ab. Als sei die alte Naturbildungskraft, die seinen Fuß, seine Hand, sein Herz, seinen Schädel, kurz seine Organe ihm verliehen, auch für ihn nach dieser Seite mehr oder minder fortan erloschen. Dafür aber trat er in eine höchst eigenartige Erweiterung, Verlängerung, Projektion gewissermaßen seiner angewachsenen Körperorgane ein, indem er sich künstliche Werkzeuge aus den Rohstoffen der umgebenden Natur herstellte. Z. B. um das erste und zweifellos auch wirklich Ursprünglichste zu nennen: indem er etwa seine einfache Hand verstärkte durch Stöcke, Hämmer, Messer, Schlag-, Stoß- und Wurfinstrumente, die er aus solchem Naturstoff durch künstliche Bearbeitung mit anderem zielgerecht herstellte und immer mehr verfeinerte und verbesserte. Wobei der Schwerpunkt von Beginn an auf dem Wörtchen zielgerecht oder zweckmäßig lag. Alle diese mit der Zeit ins unendliche variierten und vervollkommneten Werkzeuge wurden von ihm erzeugt mit der ausgesprochenen Absicht, möglichst zweckdienliche Erweiterungen und Besserungen seiner einfachen überkommenen Organe zu schaffen.
Nun hatte ja die Natur unterhalb des Menschen auch schon vielfach zweckmäßige Gebilde hervorgebracht (die Organe waren selbst zumeist solche), auch gelegentlich Tiere schon einen Anlauf zum Gebrauch solcher Werkzeuge nehmen lassen. Aber das war alles doch dort mehr oder minder noch in der Linie dunkler Bildungstriebe, Naturzüchtungen und Instinkte geblieben, während es beim Menschen jetzt in klarer eigener Zweckbewußtheit hervortrat.
Allerdings hing diese Zweckbewußtheit auch bei ihm zuletzt mit einem einzelnen Organ zusammen, das ihm die Natur schon mit auf den Weg gegeben, seinem Gehirn, so daß die neue Sache im letzten Sinne doch auch immer Natur blieb, was ja aber auch nicht bezweifelt werden soll.
Das wesentliche war nur (wenn ich mich einmal so ausdrücken soll) der große Systemwechsel, der in dieser Gesamtnatur sich hier ergab und dessen unabsehbare Folgen sich über kurz oder lang notwendig für die ganze übrige Erde geltend machen mußten, wo sonst überall noch nach dem alten System weitergearbeitet wurde. Einmal gegeben, hatte dieses Werkzeug-Prinzip ja eigentlich keine Grenzen.
Es mußte auf die Dauer fähig sein, den ganzen Umkreis aller bei Pflanzen und Tieren bisher entwickelten Anpassungsorgane und Organnützlichkeiten noch einmal neu, und zwar im ausschließlichen Dienste diesmal des Menschen abzulaufen — mit der gleichzeitigen Tendenz nicht endender Vervollkommnung. Was war auch die beste Klaue eines Löwen schließlich gegen einen Dolch oder gar eine Flintenkugel! In gewissem Sinne mußte dieses vervollkommnete Werkzeug die ganze tote Natur noch einmal mit der menschlichen zweckbewußten Intelligenz vergeistigen und so nun auch gegen das bisher Kühnste des Lebens ins Feld führen. Wobei der Zweck, sofort gesucht und immer mehr neu angespannt, zugleich das Tempo allmählich immer mehr verkürzen mußte — bot doch jede Erfindung selbst den Ansatz neuer und überbietender — und im Prinzip kein Unterschied lag, daß nicht ein erstes roh mit einem anderen Steine zu rechtgeschlagenes Steinmesser schließlich sich wirklich zu Sprengleitungen auswachsen sollte, die ganze Berge durchlochten.
Gewiß, die Anfänge waren auch hier zunächst noch primitiv. Jene ganze Eiszeit hindurch scheint auf der Erde (auch in ihren wirtlicheren Gebieten) allgemein erst ein relativ sehr niedriges Stadium der Werkzeugtechnik Jahrtausende um Jahrtausende fortbestanden zu haben. Ueberall braucht es ja seine Zeit, bis der Stein ins Rollen kommt. Wie der Mediziner von einem „Inkubationsstadium” vor Ausbruch einer Sache spricht. Immerhin sehen wir aber an den charakteristischen Resten, daß das Prinzip bereits vollgültig darin steckte. Es gab dem körperlich sonst auffällig schwachen Menschen zunächst selber jene Möglichkeit, sich gegen recht schwierige und abnorme Naturzeiten, die viel Leben sonst damals dezimiert haben, zu behaupten, wenn auch noch nicht die volle Ueberkraft, die Dinge zu ändern.
Die künstliche Feuererzeugung nahm bereits im Sinne solcher Erhaltung sehr glücklich den Kampf gegen das fatale Klima auf. Auch relativ größere, rein organisch besser bewehrte Tiere wurden mit der neuen Werkzeugwaffe bezwungen. Im frühen Sozialleben des Menschen erwies sich das von Generation zu Generation vererbbare Werkzeug als fördernder Stammesbesitz. Wir wissen ja auch, wie bereits dieser Eiszeitmensch in seinen Höhlen dieses Werkzeug schon verwertet hat, um Kunst zu treiben, zu schnitzen und zu malen, gleichsam auch damit einen Teil seines regen Innenlebens in den toten Stoff hinausprojizierend, wie die Natur unterhalb einst selber vielfach sogenannte Kunstformen angelegt hatte neben ihren Zweckorganen.
Gewandelt, wie gesagt, hat dieser ältere Mensch im ganzen aber wohl das Naturmilieu noch nirgendwo. Als er sich zum erstenmal auf Flucht oder Wanderung von einem Einbaum (künstlich gehöhlten Baumstamm) über das Wasser tragen ließ, hat er gewiß noch nicht geahnt, daß er einmal mit Kanälen Erdteile voneinanderspalten werde. Es ist sogar fraglich, ob dieser Urmensch selber Anteil gehabt hat auch nur an der Ausrottung der großen heute nicht mehr existierenden Eiszeittiere (wie des Mammut-Elefanten) — wahrscheinlich trieb er solche Naturverödung noch ebensowenig, wie bis an unsere Tage heran der afrikanische Buschmann, ehe das Feuergewehr in sein Land kam, seine Nashörner und Quaggas, so gern er sie jagte, wirklich vernichtet hat. Bekanntlich hat die ganze Eiszeitkultur noch keinen Gebrauch von Metall gekannt, wenn wir auch durch neuere Funde im Mittelmeergebiet jetzt wissen, daß sie bei ihren Jagden bereits große und höchst wirksame Bogen verwertete. Tatsächlich fällt auch die Metallnutzung erst in jenen oben erwähnten Spielraum der allerletzten zwanzigtausend Jahre Menschentums, und selbst dort noch nicht in den Anfang. Der Uebergang zur Eisenzeit liegt erst im hellsten Licht der uns nach Völkern, Jahreszahlen und Personennamen bereits genau bekannten Kulturgeschichte. Prinzipiell aber kann man wieder sagen, daß von Existenz auch nur einer ersten bronzenen Speerspitze an kein noch so großes und durch Stärke furchtbares Tier der Erde fortan dem Menschen, zumal dem sozial vereinigten Menschen, gewachsen war. Was die Kombination vom Metallwerkzeug mit der künstlichen Feuerentzündung bei einem Sprengstoff dann auf den Gipfel geführt hat.
Inzwischen und ehe es noch dazu kam, hatte aber bereits kurz nach Ausgang der Eiszeit noch eine andere Auseinandersetzung des intelligenten Menschen gerade mit der lebendigen Natur um ihn her stattgefunden, die, indirekt auch an den Begriff des vergeistigten Werkzeuges anknüpfend, doch nochmals eine prinzipiell neue Wende hineinbringen sollte.
Ihr Sonderwesen ist nochmals ein überaus interessantes.
Auf der einen Seite hat sie zweifellos den ersten Schritt einer wirklichen zwangsweisen Naturumgestaltung durch den Menschen wenigstens nach dieser Tier- und Pflanzenseite damals bezeichnet.
Andererseits aber trug gerade sie den Charakter eines bis zu gewissem Grade friedlichen Verständigungsversuchs dort an der Stirn. Eines Versuchs, die Natur, in der der Mensch sich jetzt so glücklich behauptet hatte, für seinen weiteren Zweck nicht einfach rücksichtslos umzuwerfen, sondern auf weitem Gebiet lebendig für sich zu erziehen.
Sehr kurz nach Beginn jener letzten zwanzigtausend Jahre Menschheitsgeschichte sehen wir diesen Menschen nämlich dazu übergehen, zum erstenmal Haustiere und Kulturpflanzen in Zucht zu nehmen.
Vom Standpunkt des Werkzeugs handelte es sich dabei um den lehrreichen Fortschritt des „lebendigen Werkzeugs”.
Bisher war nur lebendiges Organ (etwa die Hand) in lebloses Werkzeugmaterial (etwa Messer oder Hammer) projiziert worden. Jetzt stellen sich dazwischen noch das lebendige Tier, die lebendige Pflanze als lebende Projektion, die der Mensch für seinen Zweck an sein eigenes Organ anschloß.
Auch zu Tierzucht und Ackerbau gibt es einige Beispiele bereits aus der untermenschlichen Natur selbst, die bis heute neben uns fortbestehen. Am bekanntesten sind wohl die Ameisen, die Blattläuse hegen und melken und gewisse Nährpilze höchst sinnreich kultivieren. Immerhin bewegt sich auch das dort noch in der ziemlich dunkeln Welt vermutlich blind angezüchteter Instinkte, während der Mensch auch hier die freie Intelligenzstufe vertritt.
Der eigentliche Anfang ist allerdings auch in dieser Menschheitsgeschichte noch in etwas Schleier gehüllt. Auch dieses Prinzip ist plötzlich an jener jüngeren Wende fast auf der ganzen Breite der Völker erfüllt gewesen, ohne daß wir noch zu sagen wüßten, wo es im einzelnen begonnen hat — ähnlich wie mit dem Aufgehen des Vorhangs für uns in der Eiszeit das Werkzeugprinzip überhaupt da war.
Mit vielem Recht hat man darauf hingewiesen, daß diese trotz Schlachtens und Fruchterntens doch wesentlich friedlichere und niemals absichtlich ausrottende Hege und lebendige Aneignung zwar auch dem menschlichen Zweckgedanken entsprang, aber ganz ursprünglich weniger an grobe Nutzzwecke als vielmehr feinere Gemütszwecke angeknüpft hat.
Der ältere Mensch, auch wenn er den Herrscherstab der Erde schon unsichtbar bei sich trug, lebte doch wohl noch viel enger mit seiner Nachbarwelt in Seelenkontakt, die einst seine eigene Wiege gewesen. Sogenannte wilde und stark primitiv gebliebene Völker von heute umgeben sich leidenschaftlich gern noch jetzt mit lustigem Getier oft der seltsamsten Art, ziehen zum reinen Amüsement putzige Jungtiere auf — wie sie sich ebenso der bunten Blume als Schmuck erfreuen. Uralte Züge der „Symbiose”, des friedlichen Aneinandergewöhnens zu gegenseitigem Behagen, die auch schon durch die ganze Triebstufe der Natur zu verfolgen sind, mögen auch hier sich noch nebenher geltend machen, wie von Mensch zu Mensch, so von Mensch zu Tier und sicherlich auch von Tier zu Mensch. Ich denke da an das Nashorn, das Schillings einst aus Afrika mitgebracht, und das nicht mehr ohne eine kleine befreundete Ziege leben konnte — denke an den Marabustorch, der vor dem gleichen tierfreundlichen Reisenden selber jedesmal in die stürmischste Liebesbalz trat, wenn Schillings noch nach Jahren seinen Käfig im Zoo besuchte.
Wenn aber das einmal gegeben war als ein allgemeiner Menschenzug, der auch uns auf der Höhe der Kultur der Nachtigall lauschen und dem Veilchen zu seiner Zeit nachschwärmen läßt — so muß der wirkliche Nutzzweck sich doch allmählich ebenso notwendig auch daran angegliedert haben.
Die ungeheuere Produktion, ja Ueberproduktion der Natur bei nur einigem Schutz konnte dem Menschen nicht verborgen bleiben. Der weggeworfene Fruchtkern von der einfachen Nutzung mußte notwendig zum Anbau führen, Schonung die Kunstpflanzung nach sich ziehen. Aus der friedlichen Herrschaft, die in der vorsorgenden Hege lag, mußte aber ebenso nötig über kurz oder lang eine wahre Zucht werden, die das willkommene Geschöpf jetzt völlig werkzeughaft selber auf noch erhöhte Brauchbarkeit zu steigern suchte.
Wir beginnen erst in unseren Tagen durch rückgewendete Forschung wieder ein ungefähres Bild zu gewinnen, was für Wege der Mensch als Züchter damals wohl gegangen ist, ohne eigentliche wissenschaftliche Kenntnis, aber mit klugem Praktikerblick die gegebenen Möglichkeiten der Natur für sich ausnutzend. In den jungen Generationen auch der scheinbar konstantesten Tier- und Pflanzenarten treten immer einmal wieder gewisse vererbbare Schwankungen, sogenannte Mutationen, auf, die eine zwecktätige Absicht leicht nach bestimmter Seite weitertreiben kann. Vielleicht hat die Natur durch gewisse Summation und Auslese solcher Mutationen selber schon ihre Arten einst geschaffen. Dem Menschen aber bot sich hier, nun er mit eigener egoistischer Intelligenz herantrat, aus der alten Mutterlaune wohl ein reichliches Versuchsfeld für eigene zielgerechte Auswahl und Weiterzüchtung in der Linie seiner Interessen.
Aus Wildtieren und Wildpflanzen zunächst nur kärgsten Gehalts zog er so veredelte Kulturrassen, endlich ganz neue Kulturarten — bald den entgegenkommenden Instinkt benutzend, bald den wirtschaftlich wertvollen Ertrag ins Hundertfache summierend. Wobei die Geschöpfe, einmal in den Bereich der Zähmung, des engeren Menschenanschlusses und Menschenschutzes im Gegensatz zur freien Naturauslese entrückt, selber noch wieder ganz neuen Reichtum des Möglichkeitenspiels aus sich offenbarten. Wie ein Zauberer steht dieser Mensch heute vor uns, der in kurzer Frist eine ganze nie dagewesene Tier- und Pflanzenwelt aus dem Boden zu stampfen schien — alles doch auch hier mit den beiden Leuchten des eigenen Zwecks und des davon beseelten lebendigen Werkzeugs.
Ich verzeichne ein paar Daten (nachdem oben schon mehreres über den Ursprung und die Verbreitung unserer Kulturpflanzen gesagt wurde) speziell zu dem Wege, auf dem der Mensch so unsere bekanntesten Haustiere aus dem Wildmaterial seiner umgebenden Natur teils gleich zu Beginn damals gezogen, teils immer noch später nachhelfend sich errungen hat. Natürlich spielen dabei Vermutungen mit, da der Prozeß in keinem einzigen Hauptbeispiel mehr ins volle Licht der Geschichte fällt. Aber die Betrachtung macht sich vollauf belohnt, weil vielleicht keine zweite im ganzen so scharf den Menschen in seiner Rolle zur Natur beleuchtet — als Bezwinger und zugleich als Reformator dieser Natur.
Das bis heute interessanteste aller Haustiere ist zugleich das älteste: der Hund.
Also der Canis familiaris, wie wir seit Linnés zoologischer Namengebung ihn wissenschaftlich zu bezeichnen pflegen — gleichsam in der Notwendigkeit dieses Namens schon dokumentierend, daß der Mensch hier aus eigener Machtvollkommenheit eine neue Tierart geschaffen hat, die ebensosehr seinen Stempel trägt wie den der unabhängigen Natur.
Bei keinem zweiten Wesen, das der Mensch aus dem bestehenden älteren Naturhaushalt herausnahm und sich selbst angliederte, indem er es gleichsam geistig umgriff, hat das Geistige auch des betreffenden Tieres selbst eine solche Rolle gespielt. Keins ist ihm neben dem Nutzwert als Schutz-, Spür- und Wachttier zugleich so ständig auch Gemütswert geblieben, der sein Seelenleben noch nach viel tieferen Seiten durch die Jahrtausende jetzt bereichert hat und noch immer bereichert. Man denkt ja selten daran, daß der Mensch als Herr der Natur doch auch ein Gefühl der Vereinsamung in dieser Natur erdulden mußte. Der Hund hat ihm dieses Schicksal erleichtert, indem er nicht sein Sklave, sondern bis zu gewissem Grade sein Genosse wurde.
Andererseits kam ihm aber auch bei diesem Erstling in geradezu überwältigender Form schon jene Vielseitigkeit der Natur selbst entgegen, die ihn mit geringem Aufwände und nur ein paar ursprünglichen Blutkombinationen aus solcher einmal gewonnenen Kulturform die unendlichsten Rassen herauszüchten ließ — Rassen, die schließlich untereinander sich im Bilde fremder gegenüberzustehen scheinen, als draußen ganze Ketten streng getrennter Tierarten, und doch alle nur Menschenarbeit sind. Man denke an einen Dackel neben einem Neufundländer oder den Zwergpinscher zur riesigen Dogge.
Bei alledem bleibt aber fest, daß auch der Hund in dieser „Menschenform” während der ganzen langen Eiszeit noch nicht existiert hat. In den zahllosen Hinterlassenschaften des europäischen Höhlenmenschen dieser Erdperiode ist bisher nie der leiseste charakteristisch veränderte Knochenrest gefunden worden, der auf eine unserer zahmen Hunderassen deutete — sowenig wie sonst eine Haustier- oder Pflanzenkulturspur. Hunderte von anderen Tierknochen aus den Menschenmahlzeiten liegen dort oft noch auf engem Fleck beisammen: keiner weist die charakteristischen Bißspuren, als wenn solche Haushunde ihre doch so selbstverständliche Nachlese dabei gehalten hätten. Ebensowenig zeigt irgendein erhaltenes Höhlenbild den Hund, den die kunstverständige Hand doch ebensogut getroffen haben würde wie das Mammut oder den vom Jagdspeer gefällten Bison, die wir in den südfranzösischen und nordspanischen Bilderhöhlen so täuschend porträtiert finden.
Und doch muß die Zähmung sich schon damals ganz in der Stille wenigstens vorbereitet haben. Denn plötzlich, mit Ausgang der Eiszeit und Beginn der sogenannten Jungsteinzeit in der Technik, ist ein Hund da. Zuerst als Skelettrest angedeutet aus den Mooren und Küchenabfallhaufen Dänemarks — dann sich offenbar rasch weiter verbreitend über ein unendliches Gebiet als eine allgemein äußerst willkommene Menschheitsneuerung.
In den Tagen, da in der Schweiz und anderswo in Europa solche Jungsteinzeitler bereits in richtigen Dörfern, die auf eingerammten Pfählen im Seenrande und in den Seen selbst standen, wohnten, bellte es überall schon auch um diese ersten fast modern anmutenden Haussiedlungen.
Es ist dabei eine relativ kleine Hunderasse, die offenbar diesen ersten Vortrupp bildete: ein winziger Beller, der nur reinen Wachtdienst tat. Man denkt sich, daß er wesentlich in unserem Spitz fortlebt. Bei jenen Pfahlbauleuten hat man ihn in den Akten unserer Wissenschaft den „Torfhund” (Canis familiaris palustris) genannt, es war aber ersichtlich als Rasse nur der typische „Ur-Spitz”. Schmächtiges Kerlchen, der er, wie gesagt, war, gibt er zugleich wohl einen ungefähren Anhalt, aus was für einem Wildtier der Mensch sich seinen neuen Genossen erzüchtet hatte.
Obwohl man beim Hunde als zoologischer Art heute immer als nächste Spezies im freien Walde an den Wolf denkt, konnte solcher klaffende spitzhafte Duodez-Erstling doch wohl schwerlich vom großen Wolfbruder hergeholt sein. Irgendein mehr oder minder dem kleinen Schakal ähnlicher oder gleicher Wildhund der Eiszeit, der heute vermutlich, wie so manche europäischen Eiszeittiere, in der Natur draußen wieder ausgestorben ist, mag den Anknüpfungspunkt gebildet haben.
Weite Zeiträume hindurch mochte solches hungrige Schakalvölkchen den menschlichen Jäger der Eiszeit schon von fern begleitet haben, wie es heute noch dem Tiger in Indien folgt — in der lüsternen Absicht, selber noch ein Stücklein Beute vom Tisch des Großen zu ergattern. Und der intelligente Jäger selbst mochte dabei längst auf den feinen Spürsinn dieser Außenseiter aufmerksam geworden sein. Gelegentlich immer einmal wieder mag auch der zur Höhle seines Stammes heimkehrende Held einen Wurf solcher Jungschakale den Frauen und Mädchen dort halb im Scherz mitgebracht haben, die dann mit der naiven Tiermutterfreude, die wir noch heute an den Besucherinnen unserer Zoos vor jeder Löwen- oder Tigerkinderstube beobachten können, aufgezogen wurden. An den Menschen gewöhnt, mußten aber auch diese Nestwildlinge daheim brauchbare Nutzdinge bewähren: sie lärmten nachts, wenn ein fremder Eindringling sich näherte.
Jedenfalls ist es sehr leicht, sich mit solchen und ähnlichen Bildern noch in die entsprechende alte Situation hineinzudenken, wie ein kleiner pfiffiger Schakal, der selber Vorteil von dem klugen Großen zog und den dieser Große liebgewann und auch nicht ganz unnützlich befand, mit mancherlei Auslesen der passendsten Individuen endlich ständiger Hausgenosse werden konnte. Worauf dann die Natur selber mehr und mehr die Gestalt auf das veränderte neue Leben auch äußerlich abmodelte, bis der Spitz entstanden war.
Natürlich nicht mehr sicher zu entscheiden ist, ob die Zähmung nur einmal stattfand und von dem betreffenden Ort ausstrahlte, oder ob sie sich bei gleichem Anlaß soundsooft parallel vollzogen hat. Schakale sind ja noch heute weit über die Erde verbreitet, konnten also öfter und vielleicht auch mit mehreren ähnlichen Arten dienen, wobei doch das Produkt zunächst wohl überall ein solcher spitzhafter Kleinhund gewesen ist.
Wie die Sache aber dann weiterging, scheinen uns die gleichen Pfahlbauten auch noch als Exempel zu verraten.
Noch heute schließen (unbeschadet späterer Kreuzungen, die überall das Hundebild etwas verschoben haben) unverkennbar zwei andere Hunderassen aufs engste an unseren Spitz selbst an und führen also wohl ebenfalls noch typisches Urspitzblut: das sind unsere Pinscher oder Schnauzer und in seiner Grundform mindestens auch der Terrier. Die ersten Pinscher scheinen aber von den Pfahlbauern selbst bereits aus ihrem Spitz gezogen worden zu sein.
Je mehr indessen dann auch in den späteren Pfahlbauten die Kultur der Menschen selbst wuchs und reicher wurde, je mehr sie zu größerem Stammesbesitz überging und neben dem so lange auch hier noch allmächtigen Stein-, Holz- und Hornmaterial sich der Benutzung von Metall (zunächst der aus Kupfer und Zinn hergestellten Bronze) wirklich zuwandte — desto entschiedener mußte der Wunsch auftauchen, auch den Nutzen des Hundes über den kleinen ursprünglichen Beller und Belustiger hinaus den erhöhten Anforderungen solcher Kultur anzupassen. Andere Haustierhege, die mehr der Ernährung und Bekleidung galt, nämlich regelrechte Viehzucht, war ja inzwischen ebenfalls in Flor gekommen. Hütehunde und wirkliche Wachthunde taten hier not, dazu aber bedurfte es mehr und mehr jetzt eines nicht bloß kleinschakalhaften, sondern viel kräftigeren, größeren und wehrhafteren Hundes, wie solcher gleichzeitig ja auch für die Jagd größerer Art immer wünschenswerter erscheinen mußte.
Und so sehen wir denn folgerichtig in diesen späteren Pfahlstädten der Bronzezeit ein neues Hundeexperiment einsetzen, das vermutlich gleichzeitig auch wieder bei den verschiedensten Völkern und in den verschiedensten Zonen damals parallel ebenso durchgeführt worden ist. In den Hund wurde nämlich nun nachträglich wirklich noch Wolfsblut und damit Wolfsstärke gebracht.
Wenn auch nicht vom Spitz, so wird man doch von manchem anderen Hundetyp heute gern glauben, daß in ihm solcher Wolfseinschuß steckt. Daß unser heimischer Wolf mit Hunden sich glatt paart und vollkommen fruchtbare Junge erzeugt, steht ebenso fest. Und so taucht also in den Bronzepfahlbauten und anderen europäischen Stationen der Zeit ebenso plötzlich, wie früher der Torfspitz selbst, nunmehr ein unverkennbar wolfshafter größerer Hund als erster eigentlicher Rassenfortschritt auf. Nach dem frühesten greifbaren Schädelfunde wurde er der Bronzehund oder (von Jeitteles auf des Entdeckers Mutter etwas wunderlich bezogen) der Hund der besten Mutter (Canis familiaris matris-optimae) getauft.
Mit seiner wachsenden Stattlichkeit und Kraft hat er (neben einer Kreuzung des Spitzes noch wieder mit ihm, die als Canis familiaris intermedius bezeichnet wird) wohl die bis heute blühenden Geschlechter all unserer intelligenten Schäferhunde, energischen Hirtenhunde und in anderer Linie vermutlich auch unsere meisten echten Jagdhunde erzeugt.
In das Gewirre des engeren Stammbaumes hineinzusteigen, lohnt nicht, da es wohl im einzelnen kaum je wieder ganz enträtselt werden dürfte.
Einigermaßen deutlich scheint nur noch, daß an ein erstes Geschlecht solcher ältesten Wolfsmischung in besonders zäh-tapferer Form im hohen Norden (gegen den Pol schon zu) früh bereits auch ein Polarhund (Schlittenhund, Eskimohund) sich schloß, ohne den die Menschen dort den Kampf mit der Unwirtlichkeit ihrer Gegend überhaupt nie hätten bestehen können—von dem man also geradezu sagen kann, daß er in diesem Falle nicht bloß Helfer, sondern Bedingung fortan der mit ihm verknüpften Menschenexistenz gewesen ist. Denkbar, daß zu ihm als eine alte Edelform ursprünglich auch der schöne starke Neufundländer gehört hat, dem man heute gern glaubt, daß kein natürlicher Wolf es mehr mit ihm aufzunehmen wage.
Kreuzung von Hirtenhund oder Schäferhund und Jagdhund konnte unschwer der lustige Pudel sein, der sich als scharfe Rasse allerdings geschichtlich nicht sehr weit zurückverfolgen läßt. Und kaum in Zweifel wird man ziehen wollen, daß einer unserer beliebtesten und interessantesten heutigen Kulturhunde, nämlich der so scharf schon äußerlich individualisierte Dackel, Teckel oder Dachshund, nur eine Abirrung oder — wie man's nun nennen will — Feinspezialisierung des Jagdhundes selber ist. Noch heute wäre der treffliche Dackel mit seiner Riesenkraft in der Zwergenmaske, seinem Spüreifer und Mut geradezu das Ideal eines Jagdhundes, wenn er nicht zugleich ein so unverbesserlicher Eigenbrötler wäre, der in seiner Leidenschaft immer wieder jeder Menschenzucht spottet und sich hundertmal lieber Prügel holt, als von seinem Willen abgeht. Ich persönlich liebe ihn deshalb, denn er ist mir immer wieder der wandelnde Beweis, daß gerade der Hund, so nahe er zum Menschen getreten ist, doch nie reiner Sklave geworden ist, sondern immer einen „Selbsthund” in sich bewahrt hat. Ueber die Geschichte des Dackels im engeren ist viel Papier verschrieben worden. Zunächst sollte er mit Kurz- und Krummbeinigkeit eine reine Krankheitsform des normalen Jagdhundes sein, durch konstant gewordene rachitische Knochenverkrümmung in irgendeinem besonders ungesunden Weltgeschichtswinkel erzeugt. Davon hat ihn die neuere anatomische Forschung wieder gereinigt, indem sie auch ihn nur als eine jener gelegentlichen erblichen Mutationen nimmt, die auch sonst bei Haustieren in dieser Form aufgetaucht sind, ohne an sich deshalb eigentlich krankhaft zu sein; praktischer Nutzen bei der Jagd auf unterirdisch lebende Tiere und Spaß wohl auch an der unwillkürlichen Kasperlegestalt haben nur in diesem Falle die etwas krause Mutation fixieren lassen. Wann und wo das aber geschah, ist wieder Dackelzwist der Gelehrten unter sich. Auf uraltägyptischem Wandbilde sollte bereits ein Teckel paradieren, was doch nicht der Fall zu sein scheint. Ja, eine ägyptische Hieroglyphe „Tekal” sollte für ihn existiert haben, was aber auch leider nicht viel mehr Gewähr zu besitzen scheint als der schlechte Witz, im hebräischen Bibeltext werde dem ehrsamen König Belsazar schon „Manne Teckel” an die Wand geschrieben. So kennen wir wirkliche „Alt-Dackel” wohl frühestens aus der römischen Kaiserzeit, aber beschwören läßt sich nicht, ob sie nicht auch schon in der ersten Hundemeute mitgingen, nachdem der echte große Jagdhund einmal da war. Ist doch höchst interessant, daß die amerikanische Kultur in Peru und Mexiko für ihr Teil und sicher wohl ganz unabhängig auch irgendwann schon einmal auf Dackelzucht geraten sein muß.
Was nach dieser kurzen Generalrazzia alter oder neuer wolfshafter Nachtragsschöpfungen im Hundestamm jetzt wesentlich übrigbleibt, sind nur noch zwei auch in ihrem Außenbilde anscheinend recht festumrissene und uns noch überall umgebende Typen: nämlich die Dogge und der Windhund. Gerade hier gehen aber auch die Meinungen der Forscher am extremsten auseinander.
Hilzheimer sieht in der Dogge aller Gestalten zwar natürlich auch unzweideutiges Wolfsblut, denkt aber auch hier an sehr alte nordeuropäische Züchtung, etwa versuchsweise aus dem an sich schon sehr dickköpfigen und kurzschnauzigen mittelschwedischen Wolf — wovon dann erste Produkte auch schon in das spätbronzezeitliche Deutschland geraten wären, wo man in der Tat bereits stark doggenhafte Schädel zu finden glaubt. Umgekehrt hat der vielgewanderte Züricher Altmeister der Haustierforschung, Konrad Keller, gerade den Doggentyp diesmal wirklich möglichst weit weg rein aus Altasien herleiten wollen. Im geheimnisvollen Hochlande Tibet soll der schwarze einheimische Tibetwolf früh den noch heute dort lebenden großen doggenhaften Tibethund ergeben haben und auch die riesigen Hunde, die wir noch auf den alten assyrisch-babylonischen bildlichen Darstellungen studieren können. Waren sie bereits echte Doggen, wie Keller annimmt, so könnte sich die Doggengruppe unschwer von hier in die griechisch-römische Antike nach Alexanders abenteuerlichem Orientzug hinausverbreitet und auf gerade entgegengesetztem Wege erst nach Nordeuropa gekommen sein.

Abb. 26. St.-Bernhards-Hund.
Gelöst ist die Frage nicht, und es fechten zum Teil Allgemeinstimmungen darin gegeneinander, von denen die eine neuere prinzipiell gern alle Haustierkultur und stark überhaupt die ältere Kultur von Norden, aus Europa, herleiten möchte, während die andere, ältere, aber noch keineswegs ganz widerlegte strenger an asiatischem Einfluß und asiatischer Einwanderung festhält.
Daß der Doggenstamm selbst irgendwie auch in den uns, ich mochte sagen, aus „humanen” Gründen wieder so sympathischen Sankt-Bernhards-Hunden steckt, deren Findigkeit und Pflichttreue schon so manchen im Schnee sonst verlorenen Menschen der hohen Alpenpasse gerettet hat, scheint immerhin etwas weniger bestritten zu sein.
Auch beim Windhund muß zuerst wieder Meister Keller gehört werden. Im Prinzip ist der Windhund die denkbar äußerste „Kunstform” im Hunde, sogar noch über den Dackel hinaus — dabei in seinen großen Edelformen doch auch eine Prachtrasse, gleichsam die leichte Antilope unter den Hunden. Und nach Keller stammt er denn auch wirklich aus dem Antilopenlande Afrika. Aus dem schönen hochbeinigen abessinischen Wolf (Canis simensis) sollen die Aegypter der ältesten Dynastien zuerst imposante stehohrige Windhunde gewonnen haben, die nach Keller heute noch auf den Balearen fortleben. Von ihnen aber sei das ganze andere windige Völklein nicht nur ausgegangen (was sich wohl hören läßt), sondern hätten auch (sehr kühn) alle späteren Jagdhunde mit Einschluß des Dackels sich erst abgezweigt.
Demgegenüber behauptet wieder unser Hilzheimer, der angebliche abessinische Wolf sei eigentlich nur ein großer Fuchs, und der Fuchs habe nachweislich nie in die menschliche Hundezüchtung hineingespielt — an sich als Argument nicht absolut überzeugend. Aber auch jene angeblichen Pharaonenhunde seien gar keine Windhunde gewesen, sondern Abkömmlinge eines besonderen ägyptischen Schakals, während die echten Windhunde vermutlich von südrussischen Wölfen stammten. Das mag man nun einstweilen gegeneinander werten wie man will.
Erwähnen will ich nur noch, daß es auch einige „Hunde” heute gibt, von denen man überhaupt nicht weiß, ob sie schon Menschenzucht oder noch ursprünglicher Wildstoff sind. So der australische halbzahme „Dingo”, der vielleicht bei Entdeckung des Erdteils durch unsre Kultur noch solcher echte Wildhund war, heute aber mit allen eingeführten Rassen fruchtbar kreuzt. Wie er ursprünglich in den Kontinent der Beutel- und Schnabeltiere geraten war, ist selber noch ein Geheimnis. Und ebenso die orientalischen und afrikanischen sogenannten Pariahunde, die auch noch ein halbwildes Eigenleben neben dem Menschen zu führen scheinen. Jene altamerikanischen Kulturhunde müssen wohl sicher einheimisches Wolfsblut in sich aufgenommen haben, woran ja im Lande drüben kein Mangel war.

Abb. 27. Dingo, australischer Wildhund.
Eine reiche und wunderbare Welt, durch die man bereits auf diesem einen einzigen Haustierspaziergang geführt wird — man möchte sagen, eine ganze Kulturgeschichte für sich schon unter bestimmtem Gesichtspunkt dieser lebendigen Werkzeugeroberung.
Unser zweitinteressantestes Haustier ist dann das Pferd.
Der Mensch hatte von Beginn an von der Natur zwei erstklassige Werte mitbekommen: seinen Kopf und seine Hand. Seine schlechteste Naturgabe aber war sein Fuß. Ein alter Kletterfuß des Baumlebens, der nur unvollkommen zum Gehorgan umgeformt worden war — schlecht und schräg noch auf den ursprünglichen Greifdaumen gestützt, anstatt den Schwerpunkt, wie alle berufenen Gehtiere, mehr oder minder in die Mitte zu legen. Bei anderen Typen des Säugetieres hatte die natürliche Entwicklung dagegen gerade diese Fußgestaltung auf den Gipfel raffiniertester Technik getrieben. Und einen solchen Gipfel (wenn nicht unter Säugetieren geradezu den Gipfel) stellt das Pferd dar.
Wir kennen aus wunderbaren, besonders nordamerikanischen Knochenfunden auch außergewöhnlich genau, wie sein Fuß zustande gekommen war. Auch das Pferd als Naturprodukt war letzten Endes von fünfzehigen Ahnen ausgegangen, hatte dann aber in langer Kette vorweltlicher Zwischenstufen gleichsam Zehe um Zehe abgeworfen, bis wirklich bei ihm nur noch der reine stützende Mittelstrahl mit nur noch einer behuften Steilzehe an jedem Fuße stehenblieb. Indem auch das ganze übrige Bein sich dem einpaßte, entstand so die vollkommenste Trag- und Laufmaschine zum mühelosen Bezwingen auch des weitesten ebenen Planes — gewissermaßen das natürliche Präzisionsinstrument der flach zum Horizont durch halbe Erdteile gedehnten Steppe.
So begegnete (nachdem die ganze Tertiärzeit daran gebaut) ihm in fertiger Endform bereits der Mensch, und gerade diesen Musterersatz seiner eigensten schwächsten Stelle sich ebenfalls als Helfer zuzulegen, mußte früh ein Ideal seiner Haustieraneignung werden. Wobei auch hier wieder ein sehr einfacher und doch sehr glücklicher Sachverhalt entgegengekommen sein wird.
Das Pferd, als scheues Steppentier selbst nie Jäger, sondern Wild — war schon längst als ein extrem soziales Tier gewohnt, als Herde einem Leittier zu folgen, dessen feinste Lenk- und Warnsignale aufs genaueste befolgt werden mußten in einem ganz bestimmten eisernen Naturdrill. Der Mensch brauchte sich also bloß geschickt gleichsam in die Rolle dieses natürlichen Leithengstes einzuschmuggeln, um sofort als Reiter oder Fahrer auch alle Vorteile dieses Drills zu genießen.
Auch dieses Verhältnis wurde zuletzt allerdings nur möglich durch ein gewisses seelisches Ineinanderleben. Nicht mit Unrecht sagt man von gewissen Reitervölkern, daß sie mit ihren Pferden verwachsen wären. Die Poesie des Arabers kann sich den Menschen gar nicht mehr denken als nach dem Wort unseres Freiligrath: „gelehnt an eines Hengstes Bug.” Denn die hohe Naturtechnik in ihren harmonischen Verhältnissen hatte diesmal auch ein wirklich schönes Tier geschaffen, das die Menschenhand nur noch ein klein wenig für sich weiter zu veredeln brauchte, um einen wahren Rekord auch im künstlerischen Sinne zu schlagen.
Was nun den Hergang der Zähmung selbst anbetrifft, so ist in diesem Falle grundsatzlich kein Zweifel, daß sie sehr eng noch an die gegebene Natur anschloß; das heißt, das Kulturpferd einfach mit geringer Formänderung aus dem wilden Naturpferd selbst zog. Wozu wieder in den entscheidenden Anfangstagen sehr entgegenkam, daß der Mensch an seinen ältesten Kulturzentren auch solche Wildpferde noch in Masse vorfand. Sie belebten zeitweise alle Erdteile mit einziger Ausnahme nur des kleinen Australien, durchjagten in ungezählten Scharen auch die zwischeneiszeitlichen Steppen Europas und waren ursprünglich sogar in ganz Amerika heimisch, wo sie allerdings geschwunden sein müssen, ehe es zu einer Zähmung kommen konnte, so daß die Mexikaner und Peruaner bei Ankunft der Spanier kein Pferd besaßen und kannten.
In Europa sind die Wildpferde, solange der altsteinzeitliche Mensch noch reiner Jäger ohne Haustiere war, zunächst für ihn auch solches reine Jagdobjekt gewesen. Offenbar ein sehr ergiebiges, denn z. B. bei Solutré in Südfrankreich findet man noch heute ein ganzes riesiges Lager von Wildpferdknochen aus Tausenden von Individuen mit allen Spuren solcher primitiven Menschenjagd. Weite Zeiträume hindurch (erinnern wir uns, daß die Eiszeit mehrere hunderttausend Jahre dauerte und wiederholt von eisfreien reinen Steppenzeiten durchschnitten wurde, die man als Zwischeneiszeiten bezeichnet) mag er das so getrieben haben, wobei er aber auch hier gerade die brauchbaren Eigenschaften der kraftstrotzenden Traber allmählich kennengelernt haben wird.
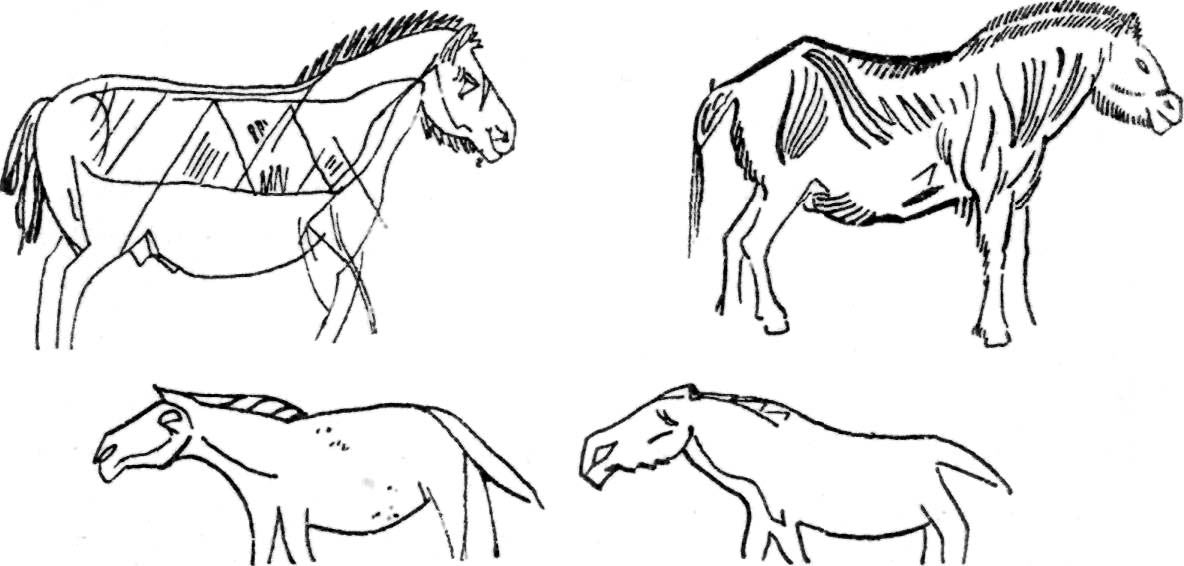
Abb. 28. Wildpferddarstellungen des diluvialen Menschen.
Wir wissen aus den zum Teil höchst vortrefflichen und lebenstreuen Wandbildern, farbigen Deckenmalereien und Kleinschnitzarbeiten, die uns dieser älteste europäische Pferdejäger in vielen seiner Wohnhöhlen hinterlassen hat, sehr genau, wie dieses alteuropäische Jagdwildpferd ausgesehen hat — eine Kenntnis, die dann noch eine glückliche Entdeckung aus neuerer Zeit ergänzt hat. Es war nämlich kein Zebra, so daß diese afrikanischen Buschsteppentiere von heute uns ein Bild nicht geben könnten. Dagegen hat sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts unverhofft herausgestellt, daß in einer heute allerdings auch recht entfernten Gegend, nämlich der innerasiatischen Dsungarei, gegenwärtig ein kleiner Rest einer ihm offenbar noch äußerst ähnlichen Altwildpferd-Form fortlebt in dem sogenannten Prschewalski-Pferde (nach dem berühmten russischen Reisenden so benannt). Das hochwillkommene Tier, das wie ein noch lebendiges Eiszeit-Fossil plötzlich wieder zwischen uns zu treten schien, konnte seither von den meisten unserer Zoologischen Gärten zu ausgiebigem Studium vorgeführt werden. Es ist ein verhältnismäßig kleines, derbes, etwas ponyhaftes Pferd mit aufrechter Bürstenmähne, gelblich mit dunkeln Beinschäften und Rückenlängsstrich, der Schwanz noch nicht völlig hauspferdhaft &mdash ganz wie es jene Bilder vielfach auch zeigen. Weiter existiert haben übrigens auch bei uns im Lande Eiszeitpferde vereinzelt wahrscheinlich noch bis weit in die historische Zeit hinein, ihr Fleisch erschien auf Klostertafeln des Mittelalters, und in Rußland ist der sogenannte „Tarpan”, der wohl auch solcher Spätrest war, erst 1876 im letzten Stück gefallen.
Für die engere Zähmungsgeschichte aber wieder besonders wichtig ist, daß den Skelettfunden nach bei diesen damals weithin verbreiteten Urwildpferden selbst bereits mehrere Varianten sieh geltend gemacht haben müssen — bei uns in Europa eine recht große, derbe neben mittleren und feineren. Eben dieser Gegensatz aber ist eigenartigerweise bis heute auch in unseren Menschzuchtformen des Pferdes durchschlagend geblieben. Neben dem Extrem des sogenannten kaltblütigen Schlages im schweren, klotzigen, kolossalen eigentlichen Arbeitsgaul steht der sogenannte warmblütige im schönen schlanken Araber mit dem feinen Gesichtsprofil, an den das Ideal fast all unserer Schau-, Zier- und Luxuspferde angeknüpft hat. In etwa also auch ein Kontrast, wie im Hunde der starke Wolfs- und der feinere Schakal-Einschlag.
Und hier ist nun heute ziemlich allgemeine Forscheransicht, daß wenigstens der derbe Gaul auch von jenem derben Wildpferdtyp stammt, also wesentlich nordisches Zähmungsprodukt ursprünglich gewesen sei. Ueber das Edelpferd dagegen herrscht wieder Hader der Weisen. Es spricht auch da wieder etwas die stärkere Liebe bald zur alteuropäischen, bald zur altasiatischen Kulturidee mit. Afrikanisch ist auch dieser Typ wohl sicher nicht, da, wie gesagt, die dort heimischen Zebras nicht in Betracht kommen. Weil aber der Araber im Orient auftaucht, könnte er urasiatisch sein, dort selbständig gezähmt aus einer der feineren Wildrassen, die eventuell ja auch dort gelebt haben könnten. Auf einem reizenden assyrischen Reliefbild des siebenten Jahrhunderts vor Christus sieht man in der Tat eine Jagd auf solche, damals offenbar im Euphrat-Tigris-Gebiet noch fortlebenden Wildpferde, und sie haben schon als solche einen wahren, wie vorangelegten Araberkopf. Dann müßten alle Feinpferde aus der nordischen Bronzezeit etwa auch schon orientalischer Import gewesen sein. Andere denken dagegen, es könnte von jeher zwei Quellen für Feinpferde gegeben haben: auch eine nordische aus einer der dort auch nachgewiesenen Feinrassen schon der Eiszeit-Pferde; und unabhängig eine allerdings wohl noch bessere im Orient.
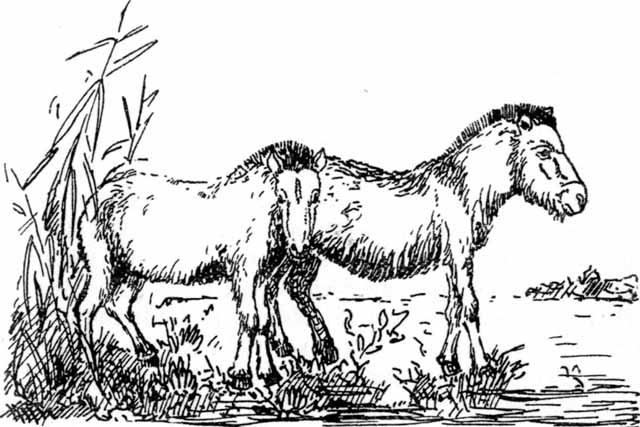
Abb. 29. Urwildpferde.
Sehr hübsch auch äußerlich noch erhalten ist der Wildpferdcharakter jedenfalls in den nordischen Ponys.
Im übrigen ging die künstliche Auseinanderzüchtung der Pferde durch den Menschen aber überhaupt nie so weit wie beim Hunde — das Pferd ist auch als Pony nie reine Spielerei geworden wie etwa der Zwergpinscher. Der Schwerpunkt blieb immer auf einer gewissen Uebermenschenkraft in ihm, die von Anfang sein Menschenverhältnis als „Beinersatz” bestimmt hatte. Und erst in unsere Zeit hinein droht ihm das Schicksal, gerade für diese ergänzende Bewegungsstärke doch überholt zu werden von der Maschine, die sich zu einem natürlichen „Tier” des Menschen zu entwickeln begonnen hat, dessen Präzision noch über das wahre Leben gehen will. Ich fände es doch tragisch, wenn dieser Weg dauernd wieder das Pferd verlieren sollte, ein Kunstwerk der Natur, das so urgeboren neben das Kunstwerk des Menschen zu gehören schien. Und ich gebe den Gedanken nicht auf, daß sich immer noch Momente finden konnten, wo die Weitererziehung des Lebens sich wertvoller erwiese, als die noch so gesteigerte Erfindung immer neuer Maschinen.
Daß übrigens nicht notwendig alle Tierzüchtungen ursprünglich im Norden liegen mußten, beweist am klarsten gleich das nächst hier anschließende Beispiel des guten Esels.
Dieser Doppelgänger des stolzen Pferdes ist ganz unzweideutig rein altafrikanisches Produkt. Die vielbesagten und vielfach sehr ungerechterweise schlechtbesagten Esel, ebenfalls äußerst wertvolle Kulturtiere, gehören auch naturgeschichtlich aufs engste zu den Pferden (ebenfalls als Einhufer), haben aber ebenso streng bis heute immer ihre Sonderart bewahrt. Auch vom Esel leben ausgesprochene Wildformen stattlichen Typs noch heute in Asien, wie im nördlichen Ostafrika. In den Eiszeitgründen Europas schweiften auch sie und wurden von den Diluvialjägern nicht minder kenntlich abgebildet. Gleichwohl sind sie nach Abzug der Eiszeit bestimmt dort nicht gezähmt worden. Die alte Idee des trefflichen Brehm, das zahme Pferd selber könne aus ihnen damals hervorgegangen sein, ruht ebenso wieder im Staube der antiquierten Akten.
Nur eine einzige heutige Wildeselform gleicht noch jetzt dem Hausesel so zum Verwechseln, daß jeder Zweifel sich erledigt: das ist aber der nubische Wildesel in Afrika mit dem Schulterkreuz, zoologisch der Asinus taeniopus. Aus ihm haben wohl schon die alten Gallastämme ihr Material genommen und das Produkt nach Aegypten vertrieben und damit den Triumphzug des Esels durch den alten wie neuen Orient angebahnt. Dieser Orient hat nie vergessen, was ihm in den zähen Gesellen geschenkt war. Wo heute bei uns ein treffliches Eseltier schreitet, da ist's aber immer eigentlich noch ein Gruß aus Afrika.
Nachträglich gekreuzt hat der Mensch allerdings (und offenbar auch das geschichtlich recht früh schon) das Pferd mit dem Esel zum sogenannten Maultier (Eselhengst auf Pferdestute), das eine in ihrer Weise nochmals ideale Kunstform gab, der bis heute nur leider der Makel der Unfruchtbarkeit anhaftet, so daß sie gewissermaßen immer wieder neu von Fall zu Fall im Rezept hergestellt werden muß.
Ich schließe noch ein anderes Haustier dabei gleich an, weil es ebenso nachweislich rein afrikanisch ist: nämlich die Hauskatze. Was die Katze allgemein so lehrreich macht, ist, daß sie noch auf eine gelegentliche Sonderquelle der Haustierbildung deutet, die eben auch nur spezifisch „menschlich” möglich war.
Weit verbreitet und uralt ist ein Brauch der Menscheit, sich zum Wappen (Totem) einer bestimmten Stammeseinheit irgendein Tier zu wählen, das dann selber in natura meist eine gewisse Verehrung genießt. Bis in unsere Stadt- und Staatswappen spielt das ja noch eine Rolle, und öfter führt es auch heute noch dazu, daß solche Tiere lebend gehalten werden: so Wölfe auf dem römischen Kapitol, Bären in Bern. Und auch das mag schon früh gewisse Tiere gewissen Stämmen gelegentlich nähergebracht haben. Verwandelte es sich aber gar in einen religiösen Tierkult mit Gottheiten in Tiergestalt, wie er im alten Aegypten jahrtausendelang blühte, so konnte ein Fall entstehen wie der unserer Hauskatze.
Es läge gewiß wieder nahe, auch bei ihr an unsere heimische Wildkatze zu denken. Aber weit gefehlt. Sie ist ein Produkt der heute noch sehr leicht zu zähmenden afrikanischen sogenannten Falbkatze (Felis ocreata maniculata) und als solches wesentlich ägyptisches Kulterzeugnis, über das uns die heiligen Katzenmumien dort noch genügende Auskunft gegeben haben. Die Falbkatze wurde noch in historischer Zeit zum Schutztier und frommen Sinnbild der Göttin Bast erklärt und so langsam durch Tempelzähmung in unsere Hauskatze übergeführt. Von Aegypten ist diese dann als auch ohne Heiligkeit netter Hausgast ins weite Mittelmeergebiet und erst nach Christi Geburt auch nach Europa gelangt. Immer bei so junger Erziehung doch nur als eine Menschengenossin gleichsam auf Reserve, an der ich wie am Dackel und noch erhöht die durchblitzenden Unabhängigkeitszüge liebe im Gegensatz zu einer unleidlichen Tantensentimentalität, die ihr auch weiter einen süßlichen Heiligenschein andichten möchte, dessen sie doch für den echten Katzenfreund mit ihrer prächtigen Individualität wahrlich nicht bedarf.
Ich gehe zum Rinde über und damit prinzipiell der Gruppe bedingterer Haustiere, die dem Menschen nie so stark seelisch nähergekommen sind, weil sie zum großen Teil ausgesprochen nur noch seinem physischen Nutzen als wandelnde Vorratskammern dienten, die er zugleich schützte, wie in ihrem Ueberfluß beschlagnahmte.
Das Rind ist dabei wieder das älteste und kostbarste Objekt und zugleich noch nicht bloß Schlachttier. Mit ihm begann nicht nur eine fortan absolut unentbehrliche Haustierzüchtung selbst, sondern es hat zugleich die Brücke gebildet zum Ackerbau. Mit vollem Rechte durfte der unlängst verstorbene ausgezeichnete Haustierforscher Eduard Hahn auf das Rind den berühmt gewordenen Satz prägen, der zugleich die Rolle des Haustiers in der menschlichen Natureroberung noch einmal allgemein charakterisiert: „Als diese Erwerbung vollzogen war, als man Milch trank und den Ochsen vor den Pflug spannte, waren wesentlich alle Erwerbungen für unsere asiatisch-europäische Kultur vorhanden; alle Neuerwerbungen sind schätzbare Erweiterungen gewesen, sie konnten aber nichts Wesentliches an den Grundzügen ändern.”
Zur Zähmungsgeschichte wieder betone ich nur zusammenfassend, daß im zahmen Rinde wesentlich, wenn nicht ausschließlich, das Blut des früher in diesem Buche schon einmal erwähnten gewaltigen Wildstieres steckt, den man den echten Ur (Bos primigenius) zu nennen pflegt.
Heute als Wildform ausgerottet, lebte er in jenen Tagen, die für die Kultivierung in Frage kommen, und auch geraume Zeiten später noch allenthalben in Europa so gut wie im Orient und selbst bis Aegypten fort. Die Babylonier haben ihn noch in bunten Emailfarben neben dem Löwen und Drachen auf ihrem neuerlich wieder freigelegten Istartor verewigt — als das ungeheure Wildtier Reem der Bibel, von dem Hiob singt, daß niemand es an die Krippe binden könne. Nun, es muß gerade das doch gelungen sein. Auf einem altgriechischen Goldbecher sieht man seinen Fang. Aber Cäsar und Plinius beschreiben ihn auch als Charaktertier gerade des deutschen Urwaldes ihrer Römerzeit, und das letzte Exemplar ist tatsächlich erst 1627 in Polen eingegangen. Nach den auch sonst erhaltenen Bildern war er groß, doch leicht, mit sehr langen, vermutlich weißlichen Hörnern mit schwarzen Spitzen, das struppige, doch kurze Haar tiefschwarzbraun bis rotbraun mit hellem Rückenstrich und weißem Kinn, Bauch und Innenbereich der Beine — also schon sehr viel mehr Urbild eines zahmen Rindes als etwa ein Wisent oder amerikanischer Bison.
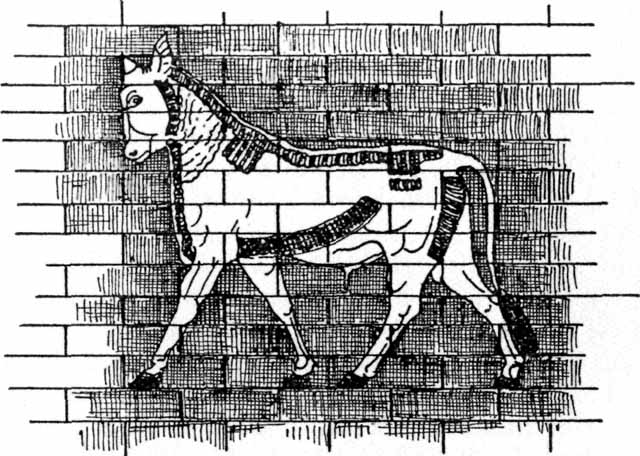
Abb. 30. Urstier. Relief vom Istartor in Babylon.
Die weite Verbreitung läßt wieder frei, die Zähmung nördlich oder östlich mehrfach zu denken. Vielleicht hat auch bei ihr ein alter Stierkult mitgespielt, wie er ja vormals noch in Aegypten fortblühte. Möglich, daß man sich zuerst an eine kleinere Natur-Variante des eigentlichen Riesenreem herangewagt hatte und erst, wie den Wolf zum Hunde, nachher auch den Riesen selbst einzüchten ließ, an den man doch sicher denkt, wenn man heute noch die kolossalen zahmen südrussischen Steppenrinder etwa im Berliner Zoo sieht. Keller hat sogar an Blutzuschuß von dem indischen wilden Banteng gedacht, dem die Zebu-Rinder entsprossen seien, doch bleibt das problematisch. Für die Gegner, wie Hilzheimer, ist auch der Zebu nur ein Rind wie andere aus dem schon zahmen Hausrinderstapel. Parallel, aber unabhängig lief ein keineswegs schlechter Versuch, auch den eigentlichen Büffel zu zähmen, der mit seiner Kraft, Genügsamkeit und Seuchenfestigkeit eine recht brauchbare Zutat wenigstens für gewisse südliche Gegenden abgeben konnte. Der zahme Büffel ist in diesem Falle sicher von dem großen Arni-Wildbüffel Indiens ausgegangen, also wieder rein orientalischen Ursprungs. Wer in Ungarn und Süditalien gereist ist, wird den kuriosen Gesellen kennen, der nicht schön ist, aber brav dient und z. B. bei Paestum die böseste Fiebergegend besteht.
Wobei wenigstens erwähnt sei, daß (sicher nur ganz lokal) von Tibet ausstrahlend in die allernächsten Nachbarländer auch der phantastische Grunzochse oder Jak (Bos grunniens), den jeder wohl aus dem Zoo in lebhafter Erinnerung hat, kultiviert worden ist — als Lasttier, Reittier und Schneepflug und außerdem noch als Träger der vielbegehrten langen „Roß-Schweife”.
Das Schwein, um es wieder gleich hier anzuschließen als Fleischproduzenten mit über 60 Prozent all unseres deutschen Fleischkonsums, ist abermals heiß umstritten in der Gelehrtentheorie.
Gegenwärtig schreibt man ihm mindestens vier Zähmungszentralen zu. In Indien und in China soll das dort heimische sogenannte Bindenschwein (Sus vittatus) die Wildform gebildet haben, deren Kulturzüchtung dann aus dem Orient schon so früh nach Europa gelangt wäre, daß sie dort noch das kleine „Torfschwein” der Pfahlbauten geliefert hätte. Demgegenüber lassen andere dieses nordische Torfschwein von einem verzwergten heimischen Wildschwein stammen, wozu wieder zweifellos bleibt, daß Pfahlbauer und andere Alteuropäer später jedenfalls auch unsere große europäische echte Wildsau in Zucht genommen haben. Nicht ganz ohne Grund hat man gesagt, das sumpfliebende Schwein sei zum älteren Menschen gern gekommen, weil er selber ein solches Dreckschwein gewesen sei, das um sich her überall einen wahren „Kultursumpf” verbreitete. Jedenfalls haben die Schweinefleischverbote des Judentums und vor allem des Mohammedanismus, die unendliche Verbreitungsgebiete dem Schweine nachträglich noch wieder verödeten und verschlossen, bewiesen, daß diesmal kein Kult gefordert hat. Auf das Verbot scheinen teils mystische, teils aber auch gut hygienische Dinge eingewirkt zu haben (das Schwein übertrug bekanntlich die böse Trichine), von denen die letzteren zum Glücke doch heute wieder genügend hinfällig geworden sind, um uns nicht dauernd den Genuß der hohen Gottesgabe des Schinkens zu verekeln.
Vom Schaf weiß man tatsächlich bis heute nicht, von welchem Wildschaf es stammen könnte. Um so merkwürdiger, wenn man an die ungeheueren Schafherden schon der orientalischen Patriarchenzeit denkt, das alte „Torfschaf” der Pfahlbauten noch hier und da lebendig findet, auch dem Widder im altägyptischen Kult begegnet und am Parthenonfries wahrhaft dämonische Riesenschafe sieht, die nach Hilzheimer wohl geeignet hätten sein können, den Odysseus und seine Leute wirklich unter dem Bauch aus der Zyklopenhohle zu tragen. Offenbar hat auch hier von früh an starkes Hin und Her im Größeneinschlag geherrscht, ohne daß doch ein bestimmtes Wildschaf als Modell deutlich würde. Keller hat an das gewaltige afrikanische Mähnenschaf unserer Zoos gedacht. Im Riesengebirge haben wir heute künstlich wieder eingeführte sardinische Wildschafe (Mufflons). Aber das echte Geheimnis will sich noch nicht lösen.
Die Ziege ist, obwohl sie bereits altes Pfahlbauinventar war, im Grundtyp ausgesprochen orientalisch. Sie stammt nicht (wieder ist das Nächstliegende nicht das richtige) vom Steinbock, diesem schönen, heute leider so gefährdeten Naturziegenbock, sondern von der etwas kleineren wilden Bezoarziege (Capra hircus aegagrus) mit immerhin auch schr stattlichem Gehörn, die noch heute von Westasien bis Kreta vorkommt. Die mehr säbelförmigen Hausziegen münden alle restlos dort ein; bei den gewundenhörnigen fahndet man immerhin noch auf ein paar gelegentliche Tropfen Fremdblut.
Eine sehr isolierte Stellung nimmt unter den Haustieren das Kamel ein, wie es denn auch zoologisch ein Sonderling ist. Die wilden Kamele sind eine alte Eigengruppe der Paarhufer, gewissermaßen auf der Schwebe zwischen Schwein und echtem Wiederkäuer eigentlich nur urweltlich noch zu verstehen, und wie eine Urweltsfratze sieht unser bekanntestes Kamel denn auch noch immer aus. Die ursprüngliche Heimat der Kamele ist wohl Nordamerika gewesen, von wo sie, selber dort erloschen, zwei lebende Ausläufer noch heute besitzen: einen über Asien und einen anderen in Südamerika, wo die sogenannten Lamas durchaus auch nur kleine Kamele darstellen. Beide überlebenden Typen aber hat der Mensch sich merkwürdigerweise angeeignet.
Ob es in Zentralasien noch heute wilde Kamele gibt, ist auch durch die neuesten Forschungen, wie es scheint, nicht absolut einwandfrei geklärt. Jedenfalls würde es sich dabei aber wohl um die Stammform des heute in ganz Mittel- und Ostasien so unentbehrlichen zweihöckerigen zahmen Kamels handeln. Während das mehr im afrikanischen Trockengebiet verwertete und dort ebenso kostbare zahme Einhöckerkamel oder Dromedar noch immer sein eigenes kleines Mysterium wahrt. Manche nehmen es bloß für eine jenseit der Zähmung selbst erst entstandene einseitige Zuchtrasse. Andere träumen auch zu ihm eine besondere Wildform, die etwa im dunkelsten Arabien einmal gelebt haben oder gar heute noch unentdeckt fortexistieren könnte.
Umgekehrt durchschweifen von den amerikanischen Lamas noch zwei ausgesprochene Wildformen bis heute in Mengen die Kordilleren als freies Jagdtier neben den seit der alten Inkazeit dort vorhandenen beiden Zahmtypen. Die Kultivierung ist hier deswegen wieder so ungemein interessant, weil sie sich ohne jeden altweltlichen Zusammenhang zeigt. Die amerikanische Urbevölkerung hatte sich das kleine Lamakamel, wahrscheinlich nur aus der einen der beiden Wildtypen, als Last- und Wolltier in seinem wolkenhohen Bergbereich schon weit vor aller spanischen Eroberung angeeignet, während ihr Pferd, Rind und Schaf unbekannt blieben. Der beste Beweis, daß Haustiererwerbung auf bestimmter Kulturstufe eine allgemeine menschliche Eigenschaft gewesen ist, zu der es keineswegs immer eines einzigen eng lokalisierten geographischen Ausgangspunktes bedurfte.
Und das kann man auch am Renntier sehen. Nur einmal hat der Mensch in diesem Renntier aus der Reihe der großen Paarhufer auch einen echten Hirsch in seine Kultureroberung gezogen. Allerdings einen der merkwürdigsten auch sonst seiner Sippe. Einen in beiden Geschlechtern geweihtragenden Hirsch, der gänzlich ausnahmsweise nicht ein Waldtier, sondern ein ausgesprochenes Polartier der baumlosen Zone war. Auf der Höhe der diluvialen Eiszeit hatte er ihn tief in der Schweiz und in Frankreich kennengelernt, bis wohin damals noch diese öde polare Tundra (Moos- und Flechtensteppe) infolge der veränderten klimatischen Verhältnisse selbst reichte. Lange war auch das Renntier hier eins seiner bevorzugtesten Jagdtiere gewesen, dessen Geweih sich ihm als besonders wertvoll für seine frühe Werkzeugtechnik erwies. Dann, nach Abzug der Eiszeit, wandte es selber sich der wirklichen heutigen Polaröde zu. Dort hat es der Mensch dann wiedergefunden, teils weiter gejagt, teils aber, weil jetzt längst auch bei ihm die Stufe der Haustiererwerbung eingesetzt hatte, auch gezähmt zu großem Segen wieder für seine eigene Behauptung in so unwirtlichem Strich. Immerhin mit so wenig Umgestaltung, daß man nur von einer recht losen Aneignung sprechen kann, die aber doch dazu geführt hat, daß ein Hirsch hier für weite Volkskreise sogar regelmäßiger Milchspender geworden ist.
Ich streife nur flüchtig noch eine kleine Reihe weiterer Fälle. Der Elefant, dieses in unseren hellen Tagen eigentlich auch nur noch urweltlich zu verstehende Riesentier, das heute eine ganze sehr isolierte Säugetierordnung für sich bildet, ist als sanftes, kluges und gleich dem Pferde schon stark sozial vorgebildetes Wesen zwar individuell vom Menschen immer einmal wieder herangezogen worden und hat sich dabei seit alters auch als famoser Arbeiter erwiesen. Ernstlich in den Kreis erblicher Artzähmung scheint er aber nie eingetreten zu sein. Weder in den Tagen der alten afrikanischen und asiatischen Kriegselefanten, noch in den heutigen hinterindischen Holzhöfen und Sägemühlen, wo man den guten Koloß persönlich immer wieder nicht hoch genug einzuschätzen weiß. Man muß ja immer noch zwischen solcher Personenzucht und echter, Generationen in sich begreifenden Haustiergewinnung unterscheiden. Im Zirkus widersteht schließlich so gut wie kein großes Einzeltier, selbst Schwein und Nilpferd nicht, solcher Personenzucht, und der Seelöwe produziert dort sogar wahre Wunder an Dressur. Aber zur Dauerzucht bedarf es vor allem auch der regelmäßigen Fortpflanzung im zahmen Stande, und daran scheint's beim Elefanten, wenigstens in der historischen großen Zähmungsepoche, gehapert zu haben; denkbar, daß hier für uns noch eine Zukunftsaufgabe liegt, falls wir nicht lange, ehe es dazu kommt, auch diese wunderbare Reliquie grandioser Tiervergangenheit ausgerottet haben.
Solche Fortpflanzungsschwierigkeiten unberechenbarer Art haben wohl ebenso den in Asien als Jagdgehilfen noch heute so beliebten Jagdleoparden oder Gepard von eigentlicher Dauerzucht ausgeschlossen.
Unser gerade umgekehrt wieder glatt genug angegliedertes Hauskaninchen stammt vom spanischen Wildkanin als vermutlich erst spätrömische und mittelalterliche Kunstform, die dann allerdings so weitgehend zahm ausvariierte, daß wir heute wie von Dahlien oder Rosen von ihr ganze Kunstausstellungen veranstalten können. Wobei neben der lustigen Sportspielerei doch auch der wahre volkswirtschaftliche Nutzen solcher Kaninchenzucht möglichst großen Stils erst den neueren Jahrzehnten so recht aufgegangen ist.
In unserm Huhn steckt, wie schon der große Darwin selbst nachgewiesen hat, ausschließlich das indische sogenannte Bankiva-huhn (Gallus ferrugineus), also wieder ein orientalischer Ursprung nicht allzu hohen Alters. In den Schweizer Pfahlbauten scheint es noch gänzlich unbekannt gewesen zu sein. Vielleicht ist auch hier an ursprünglich heiligende orientalische Kulturgebräuche zu denken. Die Umwandlung durch die Kultur ist jedenfalls eine recht nachhaltige gewesen — man denke nur an die künstlich enorm gesteigerte Fruchtbarkeit im Eierlegen.
Und der gleiche Meister Darwin, als er die Kulturrassen zum Zwecke seiner Theorie von der Naturumgestaltung der Arten studierte, hat auch die Taubenfrage geklärt. Alle unsere 124 zahmen Hauptrassen der Taube gehen auf die eine einzige weitverbreitete Wildform der schieferblauen sogenannten Felstaube (Columba livia) zurück. Man nimmt für die Zähmung abermals Altasien an, anknüpfend wohl sicher bei religiösen Taubenkulten. Man kommt immer wieder auf dieses religiöse Motiv, das eben eine ungeheuere Macht in der Menschheit war. Gelegentlich hat aber auch ein sehr merkwürdiges Nutzprinzip sich für Taube und Mensch bewährt: die alte Zähigkeit des Naturtriebes, die solche Taube immer wieder zu ihrem heimatlichen Schlage (der alten Felshöhle) zurückkehren läßt, wozu ein glänzendes Orientierungs- und Flugvermögen entgegenkommt, hatte schon in der fernen Kalifenzeit zur Verwertung als „Brieftaube” geführt. Ein anschauliches Beispiel wieder, wie stark der Kulturmensch das Tier in seine verwickeltsten Geistesinteressen als lebendiges Werkzeug zu verweben verstand.
Unsere gewöhnliche heimische Gans ist noch immer fast zum Verwechseln genau unsere einzige heute noch in Deutschland brütende Wildgans, die sogenannte Graugans (Anser cinereus), nur oft jetzt weiß mit der Neigung so vieler Haustiere zu dieser indifferenten Farbentsagung. So kannte sie schon Frau Penelope bei Homer und bezogen sie mit Liebe zu des alten Plinius Tagen die Römer gerade aus Germanien (also dem damaligen Deutschland) unter dem dort schon bräuchlichen Namen „Ganten”, die weißen Daunen für 5 Denare (etwas über 3 Mark) das Pfund. Dem Aeygypter der Pharaonenzeit ging Gänsebraten über alles, und er hatte, wie reizende Bilder noch zeigen, schon die rationelle Mast mit künstlichem Stopfen erfunden — wozu er sich für eine Weile die prächtige heimische Nilgans (Chenalopex aegyptiacus) herangeholt hatte, eine Separatzucht, die doch später wieder im Wechsel der Zeiten verlorenging.
Daß in unserer Ente desgleichen noch die überall bei uns und sonst auch weit verbreitete Wildente, unsere Anas boschas, steckt, wird auch kaum jemand bestreiten. Doch mag sie wieder mehrfach (auch unabhängig in China) kultiviert worden sein. Im Altertum bis gegen die Römerzeit (z. B. gerade auch in Alt-Ägypten) unbekannt, scheint sie immerhin ein sehr viel jüngeres Produkt als die Gans gewesen zu sein, das aber in dieser kürzeren Zeit doch schon sehr viel lebhafter in die Farbenvarianten gegangen ist. Sehr bedeutsam aber wieder: Kolumbus fand auf seiner zweiten Reise bei den Indianern von St. Domingo bereits Hausenten. Heute weiß man, daß die große südamerikanische Moschusente (Anas moschata), die bei uns noch öfter fälschlich „türkische Ente” heißt, drüben schon den alten Peruanern der Inkazeit völlig separat Modell gestanden hat.
Was ja ebenso in Altmexiko damals mit dem noch viel mächtigeren, einen Riesenbraten liefernden Truthuhn (Meleagris gallopavo) geschehen war, der einzigen wirklich höchst wertvollen Haustiererwerbung großen Stils, die wir, nachdem das Lama nie in diesem Sinne zu uns herübergelangt ist, Amerika (seit 1530) neben so vielen unschätzbaren Kulturpflanzen verdanken.
Ich verzeichne zum Abschluß noch drei Tiere, die sich wenigstens bedingt auch den „Haustieren” anschließen, dabei aber wesentlich niedrigeren Bereichen der Tierwelt als alle bisher genannten angehören.
Den Goldfisch aus dem Fischgeschlecht, den die alten Chinesen, ich möchte geradezu sagen, „erfunden” und uns um 1700 wohl zuerst übermittelt haben. Er ist noch heute nur eine in der Farbe verschönte und auch sonst etwas veränderte Karausche (als Carassius carassius auratus), die in den Zuchtrassen der sogenannten „Schleierschwänze” aber auch an phantastischer Form wohl jeden Rekord bizarrer „Züchtungsverrücktheit” des Menschengeschmacks oder -ungeschmacks heute schlägt.
Dann den Seidenschmetterling (Bombyx mori), den ebenfalls die Chinesen schon aus grauen Sagenzeiten vor bald fünftausend Jahren feiern und dessen Wert als „Menschentier” bekanntlich in dem Schutzgewebe beruht, das die Raupe zur Verpuppung um sich zieht und dem die Kultur den unschätzbaren Seidenfaden entnimmt. Lange die Grundlage eines gewaltigen Wirtschaftsmonopols Chinas als „Seidenland”, ist die Zucht der Raupe erst nach Beginn unserer Zeitrechnung über Konstantinopel auch in unser Abendland gelangt. In der jahrtausendelangen Dauer seiner eifrigen Kunstzucht, über der die wilde Stammart heute ganz problematisch geworden ist, hat eigenartigerweise auch das Insekt deutliche „vermenschlichte” Eigenschaften bekommen: die Raupe ist unselbständig geworden und will gefüttert werden, der Schmetterling heute äußerst flugschwach, und fatalerweise hat auch die Widerstandsfähigkeit gegen schädigende Pilzinfektionen abgenommen.
Andererseits kann bei solchen Insekten von eigentlicher seelischer „Zähmung” wohl kaum mehr die Rede sein, wie am besten unsere Honigbiene beweist. Das Alter auch ihres Schutzes durch den Menschen verliert sich in urgrauer Zeit. An ältesten ägyptischen Pyramidengräbern findet sich bereits ihr Bild, ja man zog sie als kleine trockene Mumie selbst noch aus wohlerhaltenen Blumengirlanden solches Pharaonensargs. Und so ist sie, buchstäblich in eigene Häuschen gesetzt vorn Bienenvater Mensch, durch die ganze obere Kultur mitgekommen und hat sich sogar jenseit Kolumbus in Amerika nachträglich aus solchem Menschenimport erneut unabhängig gemacht. Aber tatsächlich zahm ist sie trotzdem selber nie geworden in all der Zeit, und die vielen hübschen Erzählungen, daß sie den Menschen, der sie warte, genau unterscheide, den eigenen Bienenvater niemals steche und so weiter, haben sich vor der neueren Bienenforschung sämtlich als Märchen herausgestellt.
Will man den Begriff Haustier ganz ins weite treiben, so kann man übrigens auch die Auster da, wo rationelle Austernzucht heute bereits zu einer hohen Wirtschaftsquelle gediehen ist und wie zu hoffen, bald über jeden Luxus hinaus auch zu einer Volksernährungssache starken Ranges weitergedeihen wird, heranziehen, und als heiteres Kuriosum sei erwähnt, daß der alte Kaiserstaat Byzanz seinerzeit sogar alle Purpurschnecken im Meer summarisch zu fiskalischem Besitz erklärt hatte, ohne freilich eine echte Zucht in Gang zu bekommen und also vermutlich auch ohne stärkeres Interesse der freien Schnecken selbst an diesem bureaukratischen Rang.
Man hat öfter gefragt, ob diese ganze friedliche Zähmungseroberung der Natur wohl heute wesentlich zum Abschluß gelangt sei, nichts Neues mehr heranziehen, sondern (vielleicht bis auf etwas spielerischen Rassensport) für die Folge nur noch mit dem Gegebenen weiterarbeiten werde.
Für die Pflanze ist das sicher unrichtig.
Wenn wir selbst uns noch steigern, uns immer mehr ausbreiten, uns auch, wie zu hoffen, innerlich immer mehr sozial verbessern wollen, so werden wir unablässig auch weiter bemüht sein müssen, den Ertrag mindestens der Pflanze für uns in einem gewissen geraden Verhältnis ebenfalls fortgesetzt noch zu steigern.
Man muß sich klarmachen, wie der Mensch auf der Erde nach wie vor zur Pflanze steht, in was für einem konsequenten Gleichgewicht er sich zu ihr naturgegeben befindet. Als das Leben vor undenklichen Zeiten entstand, da verlieh die Natur bekanntlich nur der Pflanze die uneingeschränkte Macht, anorganischen Stoff in Lebensnahrung, also neue wirtschaftliche Grundlage des Lebens selbst, umzusetzen. Das später erst hinzutretende Tier erhielt diese Glücksgabe nicht und mußte sich gleichsam als Schmarotzer an dieser Pflanze durchpfuschen. Von diesem Tier aber ist der Mensch gekommen, also auch er noch immer in letzter Abhängigkeit von der Wirtschaft der Pflanze. Als Jäger hat er sich wohl zeitweise geholfen, indem er indirekt vom Tier selbst zehrte, aber auf die Dauer ging es doch auch bei ihm nie ohne die Pflanze. Durch die ganze Kulturgeschichte rast die ungeheure Angst, ihre Produktion könne ihn einmal im Stich lassen, was furchtbare Hungersnöte ohne Brot soundsooft zu bekräftigen schienen. Und der erste große Glücksausweg nach dieser Seite war eben die Gewinnung der Kulturpflanze selbst, die eine wachsende Gewähr des Dauergleichgewichts zu verheißen schien. Heute hört man wohl, unsere Chemie werde doch eines Tages die ganze uralte Tyrannei selbst brechen und auch uns die Kraft schaffen, gleichsam den toten Stein ohne Pflanzenzwischenweg zu Brot zu machen. Wir wissen aber auch, daß das noch stark Zukunftsmusik ohne sichere Gewähr ist. Und so werden wir einstweilen unmöglich schon vor dem weiteren Pflanzenexperiment die Hände in den Schoß legen dürfen. Mindestens werden wir versuchen müssen, den Ertrag unserer schon gegebenen Kulturgewächse noch rationell auf ein Vielfaches weiter zu erhöhen. Und es scheint, daß wir gerade gegenwärtig durch den Stand der Veränderungs- und Vererbungsforschung hier sogar am Vorabend einer höchst überraschenden Neuwende stehen. In Schweden, in Amerika, nicht zum wenigsten auch bei uns in Deutschland wird geradezu fieberhaft an solcher Vervollkommnung gearbeitet, die zu gewaltigen wirtschaftlichen Umwälzungen führen könnte. Ich möchte sagen, daß nach Jahrtausenden die Dinge gerade heute erst wieder voll in Fluß zu kommen scheinen, anstatt irgendwo stillzustehen.
Aber auch mit der Tierzüchtung, wenn sie auch immer in zweiter Reihe bleibt, werden wir so bald noch nicht fertig sein. Ich möchte hier nur zwei kleine Exernpel herausheben, immerhin den Spielraum der Möglichkeiten zu bezeichnen.
Eins, das auch wieder in das Feld reiner praktischer Nutznotwendigkeit fällt und seit einiger Zeit bereits mit größtem Nachdruck besonders von den Amerikanern betrieben wird. Unsere Kulturpflanzungen selber und weiter unser wirtschaftlich doch auch so unersetzlicher ganzer Forstbetrieb werden bekanntlich immer wieder durch furchtbare Insektenplagen in empfindlichster Weise bedroht. Man ist nun aufmerksam geworden, daß solche lnsektenschädlinge selber wieder durch andere Insekten gefährdet werden, z. B. uns feindliche Raupen durch gewisse sie vernichtende sogenannte Raupenfliegen (Tachinen). Es wurden nun drüben großartige Versuche in die Wege geleitet, solche „Schädlingsschädlinge” in systematische Menschenzucht größten Stils zu nehmen, sie künstlich einzuführen, wo sie fehlen, durch künstliche Hege in der Zahl zu steigern — kurz sie dauernd zu einer Hilfsarmee des Menschen zu erziehen, die zuletzt ganz wieder in eine rationelle „Haustierzucht” auch hier überleiten würde. Wenn man Abbildungen der bereits in Benutzung befindlichen „Tachinenhäuser” zur Zucht von Tachinen dort sieht, so hat man durchaus den Eindruck, wieder Anfänge mitzuerleben, wie sie vor Jahrtausenden einst zur ersten Aneignung der Seidenraupe oder Biene geführt haben müssen. Nur daß jetzt eine ganz anders rationelle Wissenschaft genau wie bei jenen Getreideexperimenten die Dinge lenkt.
Ein anderes Beispiel daneben zeigt eine anziehende Möglichkeit, bei der das neue Experiment weniger in die Linie der unmittelbaren Nützlichkeit, als der Erkenntnis selbst fallen würde. Bekanntlich sind in neuerer Zeit wundervolle Beobachtungen an künstlich gehegten Schimpansen auf einer Beobachtungsstation auf Teneriffa gemacht worden. Wie zu erwarten, hat sich dabei herausgestellt, daß das Seelenleben dieser Menschenaffen dem des Menschen noch um ein beträchtliches Stück näherkommt, als selbst das von Hund oder Pferd. Inzwischen ist es aber durch die Bemühungen des ausgezeichneten Dresdener Zoodirektors, Prof. Brandes, auch gelungen, die Aufzucht eines Menschaffen-Säuglings (in diesem Falle Orang) in der Gefangenschaft als praktisch durchführbar zu erweisen. Hier würde sich nun eine glänzende Aufgabe ergeben, so psychologisch ungemein interessante Tiere der obersten Menschverwandtschaft, wie Gorilla, Schimpanse oder Orang-Utan, ebenfalls generationenweise in feste Haustierzucht des Menschen überzuführen und damit ein tierisches Studienobjekt zu gewinnen, das wahrscheinlich den Hund nach allen Richtungen noch weit überflügeln würde. Natürlich keine Sache von heute oder morgen, aber doch auch noch ein Ziel.
*
Mit dem Werkzeug und dem lebendigen Werkzeug sind die beiden wesentlichsten Elemente der irdischen Natureroberung durch den Menschen gegeben gewesen. Der Ausbau fällt in den entscheidenden Zügen zusammen mit der ganzen oberen Kulturgeschichte.
Alexander von Humboldt ist vor jetzt bald hundert Jahren wohl der erste gewesen, der in seinem „Kosmos” in glänzender Darstellung gezeigt hat, wie selbst die größten, scheinbar rein politischen Ereignisse der letzten dreitausend Jahre Menschheit durchweg nur Stationen dieser fortschreitenden Naturbezwingung gewesen sind.
Er selbst legte dabei im Wortlaut allerdings das Hauptgewicht auf die „räumliche Erweiterung des Erd- und Weltbildes”, also mehr die reine Erkenntnis- und Weltanschauungsfrage. Aber es kann kein Zweifel sein und er läßt schließlich auch keinen, daß jeder Weg und jede Wende dieser Naturerforschung und Naturveranschaulichung praktisch auch ein Weg zu erweiterter Naturbeherrschung werden mußte.
Eine solche große Station im Moment, da der Vorhang über der jüngeren Geschichte endgültig für uns aufgeht, war beispielsweise die zeitweise Konzentrierung der menschlichen Hochkultur auf das Mittelmeergebiet. Statt einer unendlichen Zersplitterung in zahllose Einzelangriffe stellte sich hier für geraume Zeit gleichsam ein einziger großer Kristallisationspunkt her, in dem die uralte ägyptisch-vorderasiatische Tradition des nächsten Ostens, der aufgeklärte neue und erfindungsreiche Geist des Griechentums und die zähe, nüchterne Sachlichkeit des Römers zunächst auf einem eng abgegrenzten Gebiet eine engere Naturbezwingung auf einen ersten Gipfel führten.
Die kleinen politischen Abenteuer spielten dabei nur insofern ein, als sie unbeabsichtigt in den Dienst dieses erwachten Geisteslebens und allgemeinen Kulturzwecks traten. Die Mittelmeerländer wurden zum erstenmal ein bewußt geformter „Garten” des Menschen. Die Wüste wurde bewässert und kultiviert — man denke nur an die Aquädukte und Villen der Campagna um Rom oder die zeitweise antike Eroberung bereits der ganzen afrikanischen Nordküste bis tief in die Sahara hinein. Fruchtbare Stromgebiete wurden zur Grundlage einer ganzen engeren Landeskultur gemacht — wie der tropisch in regelmäßigen Perioden geschwellte Nil schon längst für die ägyptische. Das Bodengestein unterlag systematischer Ausbeutung (man erinnere sich des griechischen Marmors), um in herrlichen Kunstbauten menschlichen Schönheitsideen zu dienen. Die karge heimische Flora weiter Landgebiete wurde mit der üppigeren und gesegneteren von anderer Ecke des Versuchsfeldes aufgebessert und ersetzt — fast die ganze auffälligere Italienflora von heute ist ja solches reines menschliches Import- und Verpflanzungswerk. Bequeme menschliche Straßen wurden nicht nur im Zentrum etwa Kleinasiens oder Italiens selbst gebaut, sondern wie ein ungeheueres Spinnennetz von den Römern bis in die entfernteste Peripherie (Gallien, Britannien, Westgermanien) vertrieben. Auf das Meer selbst, diese urgewaltigste Macht der elementaren Natur, die lange eine Art unpassierbaren toten Weltraumes zwischen den Volkerinseln gebildet, sahen sich Flotten gestellt; noch der römische Dichter Horaz besang den ersten Helden, der dreifaches Erz um die Brust gehabt haben müsse zu dem Wagemut, ein Schiff dem Ozean anzuvertrauen; wenig später liefen die Kauffahrteiflotten dieser Römer bereits bis Sansibar, Indien und bis zum Seidenlande China.
Scheinbar rein politisch und in vergänglichen äußerlich militärischen Welteroberungsgelüsten eingestellt, erwiesen sich einzelne schon weiter ausholende Bewegungen aus diesem ersten Kristallisationszentrum des Mittelmeers dann Schritt um Schritt auch als kolossale neue Natureroberungen durch die Kultur. So der Träumerzug Alexanders des Großen durch den ferneren, noch fast mystischen Orient. Der Sieg der Römer über die Karthager, der eine dämonisch wild noch hereinragende Halbkultur vernichtete zugunsten eines fortschreitenden neuen, unendlich viel praktischeren Verstandeseinschlags. Die Germanenfeldzüge dieser gleichen Römer. Bis dann dieses römische Kaiserreich selbst auf ein paar entscheidende Jahrhunderte, immer noch vom Mittelmeer orientiert, schon einmal auch eine wirkliche innerlich friedliche Völkereinheit der damaligen Kultur herbeiführte, in der die Naturbezwingung mehr Fortschritte gemacht hat als in mehreren ganzen Jahrtausenden vorher. Gerade die Kulturtatsache dieser höchsten Römereinheit mißt man viel zu oft bloß an den paar Palastintrigen und Kaiserwechseln, anstatt sich zu vergegenwärtigen, was die ungeheuren Grenzen dieses schon einmal fest geschlossenen Kulturreichs, auf den Raum des Erdglobus eingetragen, bereits als ein ebenso einheitliches und riesiges Schaffensfeld der konsequenten Natureroberung bedeuteten.
Umgekehrt ergab aber auch der Fall dieses Reiches wieder in der Völkerwanderung, politisch bedingt durch die auf die Dauer doch so noch nicht mögliche Dimension dieser Giganten-Schöpfung und zuletzt auch ihre doch zu einseitige Mittelmeer-Konzentrierung selbst, neue glückliche Anregungen der Naturherrschaft. Das Lichtfeld der Kultur wanderte bis hoch nach Norden in Europa hinauf. Das Vordringen der arabischen Kultur schuf neue Beziehungen zwischen Orient und Abendland. Selbst im scheinbar dunkelsten Mittelalter hat die beschränkte Klosterkultur doch nie aufgehört, kleine Pionierarbeit der Naturkultivierung zu leisten, hat Wald gerodet, Fischteiche angelegt, Weinreben und Fruchtpflanzungen begünstigt, Straßen gebaut und Handelszentren geschaffen, mit denen die ,,Weltwirtschaft” anstieg — auch das ja nur ein Deckwort der fortschreitenden Naturbesitznahme rund um den Globus herum und in harmonischem Ausgleich aller Erdwerte für alle Völker dieser Erde, auch wo sie Erdteile und Weltmeere scheinbar trennten.
Einen neuen, recht eigentlich das moderne Bild einleitenden Ruck aber gab das große Zeitalter der Entdeckungen, wie es nach diesem Mittelalter sieghaft einsetzte, um rund um das alte Afrika und fast zugleich oder wenig später zu den ganz neuen Welten (auch Naturwelten) Amerikas und Australiens zu führen. Hier zum erstenmal wird, was in der Antike kaum gelegentlich angeklungen, die Geographie größter Aufmachung selbst zur Verkörperung des Erderoberungsgedankens, zugleich in der für jene Entdeckungen so entscheidenden Lehre von der Kugelgestalt der Erde bereits auch astronomisch-kosmisch befruchtet.
Auch diesmal mischt sich Kleineres, Vergängliches mit Großem, ohne doch auch so den Charakter des anregenden Zwischenmittels zu verlieren. Ich erinnere nur an die Sehnsucht nach Gold, die die Entdeckungen der Spanier zunächst so entscheidend beeinflußt hat und die, selber eng, doch eine unersetzlich treibende Kraft gewesen ist, um völlig neue Perspektiven der Naturaneignung (eine ganze neue Erdhälfte, bisher so unsichtbar für die Einheitskultur wie die Rückseite des Mondes), ungeahnter kultureller Riesenschätze wirklich voll, zu erschließen. Der gleiche Kolumbus, der in mystischer Zeitstimmung mit dem Golde der neuen Welt (die er zunächst noch für Indien selbst, nur von der anderen Globusseite erreicht, hielt) das Heilige Grab aus den Händen der Ungläubigen befreien wollte, empfand als feiner Naturbeobachter, der er daneben war, doch auch schon, wie seine Berichte zeigen, einen leisen, fast rührenden Hauch von dieser neuen Herrlichkeit, was sie der Kulturmenschheit an ungeahnten Tieren, Kulturpflanzen, solideren Bodenschätzen und räumlichen Ausbreitungsmöglichkeiten schenken könnte.
Bei der umgekehrten geographischen Eroberung damals der wirklich indischen Sundainseln (ermöglicht durch die Umsegelung Afrikas durch die Portugiesen), die spater zur Enthüllung Australiens führen sollte, hat neben dem Golde bekanntlich auch die Suche nach Gewürzen, also mehr oder minder reinen Genußmitteln, eine entscheidende Rolle gespielt. Ueber diese Genußmittel innerhalb der großen Natureroberung und Naturveredelung durch den Menschengeist wäre ja manches Besondere bis heute zu sagen. Ohne physische Reiz- und Genußmittel ist schon die lebendige Natur unterhalb des Menschen nie ganz ausgekommen: ich erinnere nur an die großen und offenbar schon uralten Einrichtungen der Ameisen und Termiten zur Erlangung gewisser Süßigkeiten, Parfüme und selbst, wie es scheint, recht starker Narkotika. Und ganz ohne solche Hilfen scheint auch der Mensch bisher nie ausgekommen zu sein. In der Naturaneignung haben auch sie also stets eine gewichtige Rolle gespielt. Die Obstveredelung zu äußerem Fruchtfleisch, die Kultur des Zuckerrohrs, die Pflege und raffinierte Zweckverbesserung der Weinrebe, die Verwandlung selbst der Milch, des Honigs und der Feldfrucht gelegentlich in gärende Rauschgetränke gehören sicherlich hierher. In beschränktem Maße wird zu erwägen sein, ob auch hier nicht wirklich dauernd naturgegebene Bedürfnisse des Menschen liegen. Während über die Gefahr des Uebermaßes und wirklicher Gifte (wie konzentrierter Alkohol oder Opium) allerdings ebenso kein Zweifel ist. Es dürfte wohl Zukunftsaufgabe sein, ohne grobe Gewaltmittel auch dabei die weise Beschränkung der goldenen Mittelstraße zu finden, vielleicht auch Genußmittel schließlich ausfindig zu machen, die dem Bedürfnis genügen, ohne doch den Korper und die Nachkommenschaft dauernd zu schädigen. Ich erwarte hier wie anderswo mehr von einer positiven als einer rein negativen Zukunftsmedizin. Was denn auch ein wirkliches Stück Natureroberung wieder mehr wäre.
Inzwischen hat aber gerade Amerika damals nicht nur die altweltliche Kultur vor eine ganz neue Natur gestellt, sondern es ist auch durch eine längst vollzogene eigene kulturelle Eroberung umgekehrt zu einem der größten Segenspenden dieser Altkultur selbst geworden. Es lohnt, bei diesem Punkt als einem der schönsten Beispiele für ineinandergreifende neuere Naturaneignung noch einen Moment enger zu verweilen.
Kolumbus, den man in seinen Schwächen aus der Zeit verstehen muß, um ihm doch in seiner persönlichen Größe gerecht zu werden, sollte mit seinem regen Blick schon auf zwei Gewächse aufmerksam werden, die nachmals von drüben her einen wahren Triumphzug wieder durch die ganze übrige Welt zu halten bestimmt waren.
Gleich auf seiner ersten Reise, deren Romantik alle Zeiten überdauert, meldeten ihm seine Leute, daß sie auf Kuba die seltsame Sitte der Eingeborenen gefunden hätten, aus gewissen Kräutern trockene Blattrollen herzustellen, die sie „Tabacos” nannten und am einen Ende anzündeten, um mit der Nase den Rauch zu schlürfen. Es war in der Tat das relativ harmlose Genußmittel des Rauchens, das hier zum erstenmal als amerikanischer Altbrauch für die andere Erdseite ins Licht ihrer Kultur trat, um sie fortan auch nicht mehr zu verlassen. In Mexiko und Peru hatten sie allerdings damals schon ein richtiges Laster aus der Sache gemacht, indem die Priester sich an Tabaksjauche heilige Offenbarungsräusche antranken.

Mais. Abb. 31. Tabak.
Und ebenso konnte nicht ausbleiben, daß Kolumbus bereits auf die einzige Kulturpflanze stieß, die alle Grundlage heimischen Getreidebaues dort drüben seit verschollenen Mythenzeiten bildete: den kulturell wie als höchste Nützlichkeit von allen Indianer-Stämmen gefeierten Mais. Noch gegenwärtig liegt der Schwerpunkt seiner Produktion mit 72 Prozent der Welternte auf Nordamerika, obwohl auch er längst gleich jener Tabakpflanze Allgemeingut der Weltkultur geworden. Als der Phantast in dem großen Entdecker an der Orinokomündung das biblische Paradies entdeckt zu haben glaubte, trat ihm gerade dort der fleißige Maisbau besonders greifbar entgegen wie eine Stimme der Realität, daß treue Menschenarbeit wohl wirklich imstande wäre, ihre wilde Erde in ein selbstgewolltes Paradies umzuschaffen.
Unendlich viel wichtiger und weltgeschichtlicher aber barg sich in den Geheimnissen des neuen Kontinents damals noch etwas, das Kolumbus noch nicht sah und das doch, möchte man wohl sagen, das wahre Gold gewesen ist, um das seine märchenhafte Fahrt allein gelohnt hätte.
Fern in den ihm noch unbekannten unwirtlichen Kordillerengebieten der südamerikanischen Westküste gegen den Stillen Ozean zu wuchs seit alters ein unscheinbares Nachtschattengewächs von leichter Giftigkeit seiner grünen Teile, dem die Natur bei sonst sehr genügsamer Lebensart doch die höchst nützliche Gabe verliehen, in Zeiten oben am Licht grünender Kraft zugleich an unterirdischen Sprossen kleine stärkehaltige Reserveknöllchen als eine Art Ueberschuß oder Sparkasse zu bilden, die in kargerer und kälterer Jahreszeit das ganze Gewächs weiterzuretten und später wieder grün aus sich hervorzutreiben geeignet waren.
Diese Spar-Knöllchen, als solche weder mit echten Früchten, noch echten Wurzeln vergleichbar, hatten nun die heimischen Bergvölker dort in ihrer Gebirgsöde bis zum Titikakasee hinauf schon als ein treffliches Nährmittel auch für den Menschen erkannt, wobei sie bald auf den Brauch kamen, in etwas geschickter Kulturzucht die Knöllchen zu derberen Knollen und noch reicherem Stärkegehalt systematisch zu erziehen, solchermaßen auch hier den schwachen Naturverstand mit dem reicheren Menschenverstände korrigierend und veredelnd. „Papas” nannten sie dabei die leckeren Eßknollen — es war aber in Peruanerspräche nur das, was nachmals das gute Wort „Kartoffel” um die Erde tragen sollte.
Erst in allerletzter Zeit haben wir genauer erfahren (ich benutze dazu eine Zusammenstellung der neuesten amerikanischen Quellenliteratur durch Prof. Franz Moewes), wie diese Uebertragung sich gar nicht so sehr lange nach Kolumbus zuerst vollzogen hat.
Bereits in alten Gräberfeldern der vorkolumbischen peruanischen Inkazeit finden sich noch heute gelegentlich trockene Kartoffelknollen als wohlerhaltene Totenbeigabe, sowie charakteristische Tongefäße in völlig unverkennbarer Kartoffelgestalt — Beweis genug, wie verbreitet wenigstens hier im stillen Winkel die Zucht damals schon gewesen sein muß.
Spanische Chronisten und Jesuitenpater der ersten nachkolumbischen Eroberungszeit beschrieben denn auch seit 1553 die „Papas” als eine überall dort kultivierte und in dem armen Hochlande unentbehrliche Art Erdnuß, die durch Kochen weich würde und eine Haut nicht dicker als eine Trüffel (mit der ein Vergleich ja überhaupt sehr nahe lag) besäßen. Und in dieser Gestalt und Bezeichnung sind die Knollen offenbar bereits durch die ganze zweite Hälfte jenes sechzehnten Jahrhunderts ebenso als Proviant und Tribut an Bord der sich verproviantierenden spanischen Schiffe an der ganzen chilenisch-peruanischen Küste gelangt — womit sie irgendwie wohl auch zuerst in natura ab und zu einmal bis ins spanische Heimatland und also nach Europa gekommen sein dürften.
Eine gewisse hartnäckige Legendenbildung hat allerdings lange mit großer Energie noch einen anderen Weg gesucht, der zuerst gerade umgekehrt über England geführt hätte.
Tatsache auch dazu ist, daß der englische Seeheld und Freibeuter Francis Drake auf der Verfolgung solcher spanischen Schiffe (bei damaligem Krach zwischen England und Spanien) 1578 unabhängig und für sein Teil im südlichsten Chile die Papas-Knollen als Indianerspeise ebenfalls kennengelernt hat.
Es ist aber nicht erweisbar bis heute, daß gerade er nun damals, über das Kap der Guten Hoffnung heimkehrend, die seltene Gabe in das lustige Altengland der Königin Elisabeth übertragen habe. Die zeitgenössischen Quellen, die sonst seiner ruhmvollen Rückkehr voll sind, schweigen sich darüber absolut aus, und erst später hat die Sage aus dem reichlich romantischen Helden auch den Heiland und Segenspender der europäischen Kartoffel machen wollen, wofür sie ihm in der braven Stadt Offenburg sogar noch im neunzehnten Jahrhundert ein mehr gut gemeintes als kritisches Denkmal gesetzt haben.

Abb. 32. Kartoffel.
Nun wollte aber der Zufall und Weltgeschichtskobold des weiteren, daß der gleiche Drake lange Jahre später noch eine zweite kolonialgeschichtliche Mission erfüllte, die abermals und noch weiter hergeholt in die Kartoffel-Legende verflochten wurde.
Er führte nämlich 1586 die Besatzung einer zunächst am Indianerwiderstand verunglückten nordamerikanischen Kolonie Virginia (heute der Union-Staat) nach England zurück, die ein anderer zeitgenössischer englischer Seefahrer und Spanierbekämpfer, Walther Raleigh, gegründet hatte.
Und auch an diesen zufälligen kleinen Hergang knüpfte eine andere Fassung jener Legende unabhängig an. Diese von Drake geretteten englischen Kolonisten sollten nach ihr zuerst echte „Papas” nach Irland gebracht haben, die sie aus Virginia selbst entnommen hätten — was an sich unmöglich ist, da südamerikanische Hochlandpapas damals im nordamerikanischen Virginien nicht vorkamen und eine offensichtliche Verwechslung mit der eßbaren Knolle der Glyzine vorlag. Höchstens also, daß Drake selbst damals aus voraufgegangenem Beutezug an spanischen Schiffen echte Kartoffeln außerdem noch hinzugebracht hatte — was doch diesmal die Legende ausdrücklich nicht will.
Sondern weil jene Virginiakolonie eine Schöpfung Raleighs war, laßt sie jetzt diesen den Einführer der Kartoffel sein. In Wahrheit ist diese Raleigh-Legende aber nachweislich erst an hundert Jahre später in Umlauf gesetzt worden, kann also wohl ganz beiseitegelassen werden.
Im amüsanten Detail wird übrigens sowohl von Drake wie von Raleigh gleichlautend erzählt, diese wilden Seefahrer hätten daheim ihrem friedlichen Gärtner die Kultur etwas unklar angegeben, der gute Mann habe also zunächst die echten Früchtchen der grünen Pflanze geerntet und, als sich solche als ungenießbar, ja giftig erwiesen, das vermeintliche böse Kraut ausreißen wollen, wobei er aber dann auf die wahren ungiftigen Erdknollen zur glänzenden Rehabilitierung gestoßen sei. Ein nettes Histörchen, das als guter Witz sich wohl öfter an die erste europäische Zucht angeschlossen haben mag.
Zum echten Hergang aber bleibt nach wie vor am wahrscheinlichsten, daß der erste Import schon kurz nach Drakes älterer Fahrt in Spanien erfolgt sei, von wo die neue Pflanze sich dann ziemlich rasch als einzelne Rarität bis Flandern, Italien, Wien, ja bis Breslau in Schlesien weitergegeben haben muß. (Eine auch spukende Legende, der Sklavenhändler John Hawkins der Elisabethzeit habe sie um 1565 von Venezuela nach England gebracht, beruht auf grober Verwechslung mit der Batate, einem tropischen Erzeugnisse der Winde Ipmoea, das rasch wegen seiner Süßigkeit und angeblichen erotischen Stimulanz, von der schon Falstaff bei Shakespeare zu sagen weiß, damals populär wurde.)
Jedenfalls beschrieben sie berühmte Botaniker der Zeit bereits seit 1588 genau nach solchen europäischen Gelegenheitsexemplaren, bildeten sie vortrefflich ab und benannten sie. Als Neuwort hatte sich in Italien wegen der besagten Aehnlichkeit mit der Trüffel Taratoufli oder Taratufoli hinzugefunden, was dann über „Tartuffel" zu unserer „Kartoffel" geführt hat. Lateinisch schlug Bauhin 1596, der genau den Zusammenhang mit den peruanischen „Papas” kannte, Solanum tuberosum vor, was nachher der große Linné übernommen hat.
Praktisch aber sollte doch noch fast ein Jahrhundert vergehen, ehe aus der botanischen Rarität auch europäisch ein erster Wirtschaftswert erstand und systematische Propaganda für solchen einsetzte.
Ueberaus genügsam, wie auch die verpflanzte Kartoffel als Kind einer rauhen Gebirgszone sich erwies, geeignet, selbst hoch im Gebirge auch bei uns (bis tausend Meter Höhe in Deutschland) auszudauern, bis zum siebzigsten Grad nördlicher Breite noch tragend und zufrieden selbst mit den kärgsten alten Sandböden der verflossenen Eiszeit, bot die Kartoffelpflanze zugleich der Erdkultur in ihren (ständig noch durch Zucht zu steigernden) Stärkereserven tatsächlich eine „Hungersnot-Reserve” ohnegleichen. Ihre Bedeutung wird auch nicht durch den Umstand herabgesetzt, daß ein arbeitender Mensch nicht ohne weiteres von ihr ganz leben kann, wenn er gesund und stark bleiben soll, sondern ihre wahre Mission lag darin, daß sie eben zu den anderen Kulturgewächsen fortan noch als wirkliche Reserve trat und jede Notlücke dort mit ihrer unverwüstlichen Eigenkraft zu ergänzen und zuzustopfen geeignet war. Und in dieser gar nicht zu überbietenden Hilfsbedeutung hat sie in der Tat den Ruf als eine der größten Erretterinnen der Menschheit vollauf wahrgemacht.
Im späteren siebzehnten und im achtzehnten Jahrhundert nach den unsagbaren Nöten des Dreißigjährigen Krieges begann man das sehr allgemein endlich einzusehen. In Frankreich erwarb sich in den Jahren vor der Revolution der Chemiker Parmentier das Verdienst einer besonders nachdrücklichen Propaganda unter gleichzeitigem Experiment auf noch immer verbesserte Kulturrassen. Auch in Preußen geschah in diesem Jahrhundert viel, unter manchem Widerstand der Bauern selbst gegen das fremde Gewächs. Die Engländer trieben sie durch ihr Kolonialreich zugleich in die ganze übrige Alte Welt hinaus. Schließlich paukten furchtbare Hungersnöte bis ins neunzehnte Jahrhundert immer mehr die absolute Notwendigkeit ein. Noch drohten böse Krankheiten und Schädlinge mehrfach das gewonnene Spiel zu verderben: beide Male wieder aus Amerika selbst eingeschleppt, so gegen Mitte des Jahrhunderts der Kartoffelpilz, später, in der zweiten Hälfte, der Kartoffelkäfer. Aber der Siegeslauf war nicht mehr ernstlich aufzuhalten.
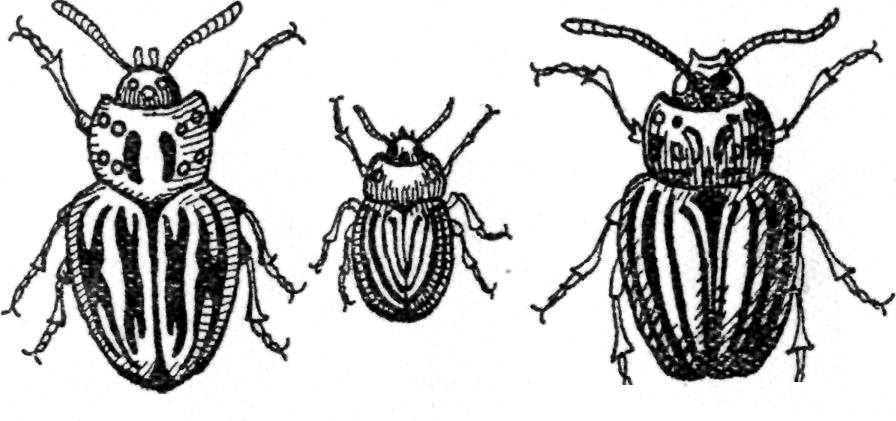
Abb. 33. Kartoffelkäfer in verschiedenen Färbungen, zweieinhalbmal vergrößert.
Wenn man heute auf die Welternte von anderthalb bis zwei Millionen Tonnen sieht, so begreift man, was auch hier für ein Stück Erderoberung getan war in der Linie von einem solchen alten Inkagrabe bis zu den unabsehbaren Kartoffelständen der Gegenwart von Schweden bis nach China.
Es ist nur ein Einzelbeispiel — und doch zeigt es die ganze Macht des Menschen in der Natur: wie er ein Knöllchen Reservestärke im fast rührend bescheidenen Naturhaushalt einer stiefmütterlich behandelten Gebirgsöde zu einer Erdenmacht erhoben hat, an der das Glück und die wirtschaftliche Sicherheit von Millionen Menschen heute hängen.
Auf das Zeitalter der Entdeckungen folgte in den Tagen zwischen Galilei und Newton die eigentliche engere Begründung der modernen Naturwissenschaft.
Der Begriff des Naturgesetzes klärte sich darin — zugleich mit der fortschreitenden Ueberzeugung, daß dieses Naturgesetz ein einheitliches sei vom kleinsten irdischen Ereignis bis zum fernsten Nebelfleck des Alls und daß es eine innere Gewähr der Undurchbrechbarkeit biete, die das Wunder ausschließt. Robert Mayers Gesetz von der Erhaltung der Energie ist im neunzehnten Jahrhundert ihr schärfster Ausdruck geworden.
Das Vertrauen auf diese ewig gleiche gesetzliche Naturnotwendigkeit und damit Natursicherheit für unsere Benutzung ist von da ab auch die Grundlage der modernen Naturbeherrschung gewesen. Auch sie stellte sich immer mehr auf das unverbrüchliche Gesetz ein, arbeitete mit ihm, verließ die letzte Hoffnung auf das Mystische und den Spuk, die selbst in die klare Werkzeugbenutzung so lange noch hineingespielt. Auch alle Veredelung, alle Vergeistigung der irdischen Natur fortan nur durch das klug verwertete und gerichtete Naturgesetz selbst! Es gilt nicht mehr den Wassergeist zu beschworen, sondern einen Damm gegen die Flut in der Folgerichtigkeit der Dinge zu errichten.
Das Werkzeug selbst wird dabei aber mehr und mehr zum reinen Ausdruck der Energie als solcher. Auf diesem Energieanschluß hat sich bereits unsere ganze Naturtechnik der letzten hundert Jahre so gut wie ausschließlich aufgebaut. Mit der Dampfkraft, dann der Elektrizität.
Wie die rein forschende Erkenntnis allmählich das staunenswerte Werk fertigbrachte, die ganze Vergangenheit wieder bis in die Länder und Wälder der Urwelt rückwärts neu aufzurollen, so holte diese Technik aus der Steinkohle die uralte gespeicherte Sonnenenergie solcher Urwelt praktisch wieder heraus. Jeder Wasserfall wurde als eine Energiemaschine erkannt, geeignet, wie ein Riese des Märchens für uns zu arbeiten. Dieser Dinge ist bis heute kein Ende. Vielleicht werden wir die Mondanziehung in Ebbe und Flut bald für uns wirken lassen. Und bereits verheißt die künstliche Zertrümmerung des Atoms, in dem wir ein ganzes Weltsystem für sich erkannt haben, nachdem früher die letzte Schranke aller Dinge ewig undurchbrechbar hier gesetzt schien, die Möglichkeit ungeahnt riesiger völlig neuer Energiequellen.
Aus dieser bewußten Energietechnik an Stelle des schlichten alten Handwerkszeuges aber sind wieder neue räumliche Erweiterungen zugleich erwachsen. Die geographische Entdeckungsgeschichte steht heute nahe dem letzten Ziele. Dafür erheben sich jetzt die neuen Fernblicke des Fluges. Schon erscheinen die geheimnisvollen Höhen der Atmosphäre, des „Luftozeans”, nicht mehr unbezwinglich, und der technische Traum wagt sich sogar an die Grenzen des leeren kosmischen Raumes.
Es kann aber nicht ausbleiben, daß auch der Mensch selbst sich gleichsam als Werkzeug erweitert. Er schaut tiefer in die Bausteine seiner Organe, die Technik seines Zellenstaates selbst hinein — entdeckt auch da wunderbare Gesetze, die sich ebenfalls zweckgerechter lenken lassen.
Seit das Mikroskop ihm seine bösesten Gesundheitsfeinde in den Kleinsten, den Bakterien und Protozoen seiner organischen Mitwelt, gezeigt hat, ist er dabei, auch seine organische Selbsteinstellung zur Natur neu zu regulieren. Ein durch und durch körperlich gesundes Geschlecht taucht als Ideal auf, vielleicht länger lebend oder doch später alternd, jedenfalls auch alle seine Organe in voller naturgegebener Kraft auslebend.
Zuletzt auf diesem Wege verschwimmt wieder der Gegensatz von Organ und Werkzeug — auch das körperliche Organ wird zum unendlich vervollkommneten Werkzeug des Geistes.
Wobei verbesserte soziale Möglichkeiten auch die Schätze dieses Geistes immer stärker und ungehemmter für die Gesamtmenschheit heranziehen werden — kein Saatkorn, das die Natur in diesem ihrem höchsten Geheimnis für uns aussät, daneben fallen lassend.
Vielleicht, daß diese Natur selber auch im äußeren Erdenbilde ihrer Veredelung durch den Menschen noch entgegenkommt. Wie sie diesen Menschen einst durch die Eiszeit geführt, die er doch schon mit dem ersten schwachen Werkzeug bestand, so könnte sie noch wieder auch die wärmeren Tage der alten Tertiärzeit neu für ihn heraufbeschwören. Denn das große geologische Spiel als solches geht, genau wie das noch größere kosmische in Sonnen und Milchstraßen, auch weiter seinen Weg.
Jedenfalls haben wir in absehbaren Zeiten keinen Anlaß, an Naturkatastrophen zu glauben, denen dieser allerseits erwachte Mensch der beherrschten Energien nicht ebenfalls gewachsen wäre. Wenn er nur einsieht, daß diese ungeheure Aufgabe einer Veredelung und Vergeistigung der Natur auf höheren Zweck untrennbar verknüpft sein muß mit seiner eigenen geistigen Arbeit an sich selbst — der Arbeit, die ihn seine Kraft nicht im wilden Menschengegensatz untereinander vergeuden läßt, sondern in geläuterter und friedlicher Kultureinheit und Kulturgemeinschaft Hand in Hand dem unendlichen Ziele zuführt.

